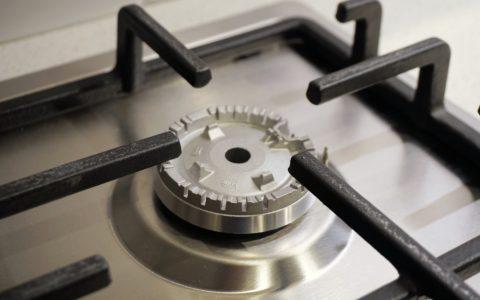Eine Preisanpassungsklausel in einem Erdgassondervertrag, nach der sich der Arbeitspreis für die Lieferung von Gas zu bestimmten Zeitpunkten ausschließlich in Abhängigkeit von der vertraglich definierten Preisentwicklung für Heizöl ändert, hält bei ihrer Verwendung im unternehmerischen Geschäftsverkehr der Inhaltskontrolle gemäß § 307 Abs. 1 BGB stand; dies gilt auch für eine Preisanpassungsklausel, nach der sich der Grundpreis für die Lieferung von Gas in Abhängigkeit von einem vertraglich bestimmten Lohnpreisindex ändert[1].

Wie der Bundesgerichtshof bereits entschieden hat, sind formularmäßige Abreden, die Art und Umfang der vertraglichen Hauptleistung und der hierfür zu zahlenden Vergütung unmittelbar bestimmen, gemäß § 307 Abs. 3 Satz 1 BGB von der gesetzlichen Inhaltskontrolle nach § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB ausgenommen[2]. Hiervon zu unterscheiden sind die kontrollfähigen (Preis) Nebenabreden, also Abreden, die zwar mittelbare Auswirkungen auf Preis und Leistung haben, an deren Stelle aber, wenn eine wirksame vertragliche Regelung fehlt, dispositives Gesetzesrecht treten kann. Anders als die unmittelbaren Preisabreden bestimmen sie nicht das Ob und den Umfang von Entgelten, sondern treten als ergänzende Regelungen, die lediglich die Art und Weise der zu erbringenden Vergütung und/oder etwaige Preismodifikationen zum Inhalt haben, „neben“ eine bereits bestehende Preishauptabrede. Sie weichen von dem das dispositive Recht beherrschenden Grundsatz ab, nach dem die Preisvereinbarung der Parteien bei Vertragsschluss für die gesamte Vertragsdauer bindend ist, und sind daher einer Inhaltskontrolle unterworfen (§ 307 Abs. 3 Satz 1 BGB). Dabei macht es keinen Unterschied, ob sie dem Verwender das Recht zu einer einseitigen Preisänderung einräumen oder eine automatische Preisanpassung zur Folge haben[3]. Damit bleibt für die der Überprüfung entzogene Leistungsbeschreibung nur der enge Bereich der Leistungsbezeichnungen, ohne die mangels Bestimmtheit oder Bestimmbarkeit des wesentlichen Vertragsinhalts ein wirksamer Vertrag nicht mehr angenommen werden kann[4].
Ob eine Klausel einen kontrollfähigen Inhalt aufweist, ist durch Auslegung zu ermitteln, die der Bundesgerichtshof selbst vornehmen kann[5]. Allgemeine Geschäftsbedingungen sind nach ihrem objektiven Gehalt und typischen Sinn so auszulegen, wie sie von verständigen und redlichen Vertragspartnern unter Abwägung der Interessen der regelmäßig beteiligten Verkehrskreise verstanden werden, wobei die Verständnismöglichkeiten des durchschnittlichen Vertragspartners zugrunde zu legen sind[6]. Zweifel bei der Auslegung gehen nach § 305c Abs. 2 BGB zu Lasten des Verwenders. Außer Betracht bleiben dabei nur solche Verständnismöglichkeiten, die zwar theoretisch denkbar, praktisch aber fern liegend und nicht ernstlich in Betracht zu ziehen sind[7].
Nach diesen Grundsätzen ist bei der Beurteilung der für die Ermittlung des Grund- und Arbeitspreises maßgeblichen Berechnungsformeln zu differenzieren. Diese Berechnungsformeln haben zwei Funktionen, die im Hinblick auf ihre Kontrollfähigkeit unterschiedlich zu beurteilen sind. Sie enthalten einerseits – darin ist dem Berufungsgericht zuzustimmen – die gemäß § 307 Abs. 3 Satz 1 BGB nicht kontrollfähige Vereinbarung über die Höhe des bei Vertragsbeginn geltenden Grund- und Arbeitspreises (Preishauptabrede). Der daraus zu errechnende anfängliche Grundpreis in Höhe von 14 €/Monat und der anfängliche Arbeitspreis in Höhe von 3, 039 Cent/kWh unterliegen – wie jeder bei Vertragsbeginn vereinbarte Ausgangspreis – nicht der Inhaltskontrolle nach § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB[8].
Ddie Berechnungsformeln regeln aber zugleich auch zukünftig eintretende Preisänderungen. Insoweit handelt es sich bei den Berechnungsformeln nicht um die Preishauptabrede zur Ermittlung der Anfangspreise für den Grund- und Arbeitspreis, sondern – im Sinne der Bundesgerichtshofsrechtsprechung[9] – um der Inhaltskontrolle unterliegende Preisnebenabreden, die künftige Preismodifikationen zum Gegenstand haben. Die Berechnungsformeln in Ziffern 5.1 und 5.2 der Anlage 2 sind nicht deshalb, weil sie (auch) den bei Vertragsbeginn geltenden Anfangspreis bestimmen und insoweit nicht kontrollfähig sind, der Inhaltskontrolle insgesamt, also auch insoweit entzogen, als sie künftige, noch ungewisse Preisanpassungen regeln.
Mit den Berechnungsformeln in der Preisanpassungsklausel haben sich die Parteien auf einen bei Vertragsbeginn geltenden – der Inhaltskontrolle jeweils nicht unterworfenen – bestimmten Grundpreis in Höhe von 14 € und einen bestimmten Arbeitspreis in Höhe von 3, 039 Cent/kWh geeinigt. Das ergibt sich schon daraus, dass diese Anfangspreise, die sich aus den Berechnungsformeln ergeben, auch in bezifferter Form ausgewiesen sind. Sie waren damit bei Vertragsschluss keineswegs „variabel“, sondern standen fest.
Davon abgesehen reicht es für die Annahme einer hinreichend bestimmten, der Inhaltskontrolle entzogenen Preisvereinbarung (Preishauptabrede) aus, dass der für den Zeitpunkt des Vertragsbeginns vereinbarte Grund- und Arbeitspreis bei Vertragsschluss bestimmbar ist[10]. Das ist bei den Berechnungsformeln in der vorliegenden Preisanpassungsklausel hinsichtlich des bei Vertragsbeginn geltenden Grund- und Arbeitspreises selbst dann der Fall, wenn die Anfangspreise nicht – wie hier – im Vertrag ausdrücklich beziffert worden wären.
Die Berechnungsformeln der Preisanpassungsklausel sind dagegen nicht gemäß § 307 Abs. 3 Satz 1 BGB der Inhaltskontrolle entzogen, soweit sie künftige Preisänderungen regeln, deren Umfang und Höhe bei Vertragsschluss noch nicht absehbar waren. Insoweit handelt es sich bei den genannten Berechnungsformeln um Preisnebenabreden, die – wie ausgeführt – nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs der Inhaltskontrolle unterworfen sind[11].
Der unterschiedlichen Beurteilung der Kontrollfähigkeit ein und derselben Berechnungsformel – je nach ihrer Funktion – steht die bisherige Bundesgerichtshofsrechtsprechung nicht entgegen. Der Bundesgerichtshof hat bereits entschieden, dass § 307 Abs. 3 Satz 1 BGB die Inhaltskontrolle einer Preisanpassungsklausel nicht hindert, wenn – wie hier – ein vertraglich bezifferter, nicht kontrollfähiger Ausgangspreis nach derselben Formel berechnet worden ist, die auch für periodische Preisanpassungen maßgeblich sein soll und daher insoweit kontrollfähig ist[12].
Aus der Bezeichnung des Grund- und Arbeitspreises als „variabel“ in Ziffern 5.1 und 5.2 der Anlage 2 ist entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nicht herzuleiten, dass die Berechnungsformeln insgesamt – also auch insoweit, als sie für künftige Preisänderungen maßgeblich sind – als nicht kontrollfähige Preishauptabreden anzusehen wären. Die Formulierung ist lediglich als Hinweis auf periodisch mögliche Preisanpassungen zu verstehen[13].
Wie der Bundesgerichtshof entschieden hat, trifft die gegenteilige Auffassung, nach der eine sowohl für die Berechnung des Anfangspreises als auch für spätere Preisänderungen maßgebliche Berechnungsformel als eigentliche Preisabrede gemäß § 307 Abs. 3 Satz 1 BGB der Inhaltskontrolle insgesamt entzogen sei, nicht zu, weil sie Möglichkeiten zur Umgehung der Inhaltskontrolle eröffnet und damit dem Schutzzweck des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht gerecht wird. Sie knüpft für die Frage nach der Kontrollfähigkeit einer Preisklausel allein an deren sprachlichtechnische Ausgestaltung und nicht an die Funktion und den Regelungsgehalt der Klausel an. Die Kontrollfähigkeit einer Berechnungsformel für zukünftige Preisänderungen hängt nicht davon ab, ob sich mit derselben Berechnungsformel auch der Anfangspreis ermitteln lässt. Ebenso wenig richtet sich die Kontrollfähigkeit einer solchen Klausel hinsichtlich zukünftiger Preisänderungen danach, ob ein bestimmter oder mit Hilfe der Berechnungsformel bestimmbarer Anfangspreis als „variabel“ bezeichnet wird. Denn die bloße Regelungstechnik ändert nichts an den voneinander abgrenzbaren Funktionen der Berechnungsformel hinsichtlich der Bestimmung des Anfangspreises einerseits und künftiger Preisänderungen andererseits[14].
Wollte man Preisberechnungsformeln einer Inhaltskontrolle vollständig entziehen, weil sie nicht nur der Berechnung künftiger Preisänderungen, sondern auch der Bestimmung des bei Vertragsbeginn geltenden, im Vertrag nicht bezifferten oder als variabel bezeichneten Anfangspreises dienen, wäre – wie die Revision zu Recht geltend macht – der Umgehung der Inhaltskontrolle von Preisänderungsklauseln Tür und Tor geöffnet. Denn damit hätte es der Klauselverwender in der Hand, durch die sprachlichtechnische Gestaltung einer Preisbestimmungsregelung über deren Kontrollfähigkeit selbst zu bestimmen. Eine derartige Umgehung der Inhaltskontrolle von Preisänderungsklauseln liefe dem durch die AGB-rechtliche Inhaltskontrolle bezweckten Schutz des Klauselgegners vor der Inanspruchnahme einseitiger Gestaltungsmacht des Verwenders zuwider[15].
Selbst wenn jedoch die gegenteilige Auslegung als vertretbar anzusehen wäre und die Berechnungsformeln im Sinne einer der Inhaltskontrolle insgesamt entzogenen Preishauptabrede verstanden werden könnten, wäre eine solche Auslegung nicht maßgebend. Vorrang hätte auch dann die differenzierende, auf die unterschiedlichen Funktionen der Berechnungsformel abstellende Beurteilung. Denn Zweifel bei der Auslegung gehen zu Lasten des Verwenders (§ 305c Abs. 2 BGB). Danach ist das für den Kunden günstigere Verständnis einer Klausel zugrunde zu legen. Für den Kunden ist das Verständnis günstiger, das die Klauseln nicht als kontrollfähige Preisabrede erscheinen lässt, sondern den Weg zu einer inhaltlichen Angemessenheitskontrolle nach § 307 Abs. 1 BGB eröffnet[16]. Das ist im vorliegenden Fall die differenzierende Auslegung, nach der die Berechnungsformeln nur hinsichtlich der vereinbarten Anfangspreise nicht kontrollfähig sind, während sie eine kontrollfähige Preisnebenabrede darstellen, soweit sie zukünftige Preisänderungen zum Gegenstand haben[17].
Die Feststellung, ob eine Klausel die Grenzen eines angemessenen Interessenausgleichs im Sinne des § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB überschreitet, kann nicht ohne Berücksichtigung der Art des konkreten Vertrags, der typischen Interessen der Vertragschließenden und der die jeweilige Klausel begleitenden Regelungen getroffen werden[18]. Die Abwägung der beiderseitigen Interessen führt im vorliegenden Fall zu dem Ergebnis, dass die von der Klägerin verwendeten Bestimmungen in Ziffern 5.1 und 5.2 der Anlage 2 im unternehmerischen Geschäftsverkehr nicht zu beanstanden sind[19].
Der Verwender von Preisanpassungsklauseln in Allgemeinen Geschäftsbedingungen hat – insbesondere bei auf Dauer angelegten Geschäftsverbindungen – ein anerkennenswertes Bedürfnis daran, seine Preise den aktuellen Kosten- oder Preisentwicklungen anzupassen. Auf Seiten des Kunden ist dagegen dessen Interesse daran zu berücksichtigen, vor Preisanpassungen geschützt zu werden, die über die Wahrung des ursprünglich festgelegten Äquivalenzverhältnisses hinausgehen[20].
Der Bundesgerichtshof hat ein berechtigtes Interesse auch von Gasversorgungsunternehmen, Kostensteigerungen während der Vertragslaufzeit an ihre Kunden weiterzugeben, grundsätzlich anerkannt[21]. Wird die Preisanpassung auf der Grundlage der Entwicklung von Kostenelementen herbeigeführt, so ist die Schranke des § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB jedoch überschritten, wenn solche Preisanpassungsbestimmungen dem Verwender die Möglichkeit einräumen, über die Abwälzung konkreter Kostensteigerungen hinaus den zunächst vereinbarten Preis ohne jede Begrenzung anzuheben und so nicht nur eine Gewinnschmälerung zu vermeiden, sondern einen zusätzlichen Gewinn zu erzielen[22].
Nach der Bundesgerichtshofsrechtsprechung kann in einem langfristigen Vertragsverhältnis ein berechtigtes Interesse nicht nur an der Verwendung einer Kostenelementeklausel, sondern auch einer Spannungsklausel bestehen. Eine gleitende Preisentwicklung durch Bezugnahme auf ein Referenzgut, das den Gegebenheiten des konkreten Geschäfts gerecht wird und deshalb für beide Vertragsparteien akzeptabel ist, vermeidet auf beiden Seiten die Notwendigkeit, einen langfristigen Vertrag allein deshalb zu kündigen, um im Rahmen eines neu abzuschließenden Folgevertrags einen neuen Preis aushandeln zu können. Sie sichert so zugleich stabile Vertragsverhältnisse und die im Massengeschäft erforderliche rationelle Abwicklung[23].
Nach diesen Grundsätzen halten die in Ziffern 5.1 und 5.2 der Anlage 2 enthaltenen Preisänderungsbestimmungen der Inhaltskontrolle gemäß § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB stand, soweit die Klägerin diese nicht gegenüber Verbrauchern, sondern gegenüber Unternehmen wie der Beklagten verwendet.
Bei der Bestimmung zur Anpassung des Arbeitspreises handelt es sich um eine Spannungsklausel. Denn der Preis für leichtes Heizöl stellt keinen Kostenfaktor, sondern einen Wertmesser für die von der Beklagten zu erbringende Leistung dar, weil er als solcher und ohne Rücksicht auf die Kosten der Beklagten die Höhe des Arbeitspreises für Gas bestimmen soll[24]. Für Gaslieferungsverträge mit Verbrauchern hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass Spannungsklauseln der vorliegenden Art, nach denen sich der Arbeitspreis für Gas entsprechend der Preisentwicklung für leichtes Heizöl ändert, wegen unangemessener Benachteiligung der Kunden unwirksam sind[25].
Diese für Verbraucherverträge entwickelte Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist auf den unternehmerischen Geschäftsverkehr aus den im weiteren BGH, Urteil vom 14.05.2014[26]) näher dargelegten Gründen nicht übertragbar. Ob die Bindung des Gaspreises an den Marktpreis für leichtes Heizöl sachgerecht und akzeptabel erscheint, unterliegt der kaufmännischen Beurteilung und Entscheidung des als Unternehmer handelnden Gaskunden, die einer gerichtlichen Überprüfung im Rahmen der AGB-rechtlichen Inhaltskontrolle nicht zugänglich ist. Es ist in einer marktwirtschaftlichen Ordnung Aufgabe des Unternehmers, selbstverantwortlich zu prüfen und zu entscheiden, ob ein Gaslieferungsvertrag, der eine Bindung des Arbeitspreises für Erdgas an den Preis für leichtes Heizöl vorsieht, für ihn annehmbar ist. Es ist dagegen nicht Aufgabe der Gerichte, diese unternehmerische Entscheidung des Kunden für eine Ölpreisbindung darauf hin zu überprüfen, ob sie sachgerecht ist, und sie gegebenenfalls zu Gunsten des einen Unternehmens sowie zu Lasten des anderen zu korrigieren[27]).
Diese Erwägungen gelten entsprechend für die in der Preisanpassungsklausel verwendete Regelung, die den Grundpreis von der Entwicklung des dort näher definierten Monatstabellenlohns abhängig macht.
Mit dem Grundpreis werden im Rahmen eines Energieversorgungsverhältnisses typischerweise die Investitions- und Vorhaltekosten des Versorgungsunternehmens abgegolten. Bei diesen langfristig beim Energieversorgungsunternehmen entstehenden Kosten handelt es sich vor allem um Material- und Lohnkosten[28].
Die Verwendung einer an einen Lohnpreisindex anknüpfenden Preisgleitklausel zur Ermittlung des Grundpreises benachteiligt jedenfalls Unternehmen wie die Beklagte nicht unangemessen. Ebenso wie bei einer an den Ölpreis gekoppelten Arbeitspreisgestaltung[29] unterliegt es der kaufmännischen Beurteilung des unternehmerischen Gaskunden, ob die Bindung des Grundpreises an einen bestimmten Lohnpreisindex für ihn sachgerecht und akzeptabel ist. Die in pauschalierter Form erfassten Lohnkosten stellen einen wesentlichen Bestandteil der typischerweise mit dem Grundpreis abgegoltenen verbrauchsunabhängigen Kosten des Versorgungsunternehmens dar. Die Kopplung des Grundpreises an eine vorab definierte Lohnpreisentwicklung ist gerade in Sonderverträgen mit größeren Kunden üblich[30]. Auch ist dem Verwender aufgrund der mathematischen Funktionsweise einer solchen Preisgleitklausel kein Ermessen bei Preiserhöhungen eingeräumt. Eine Befugnis des Verwenders zu Gewinnsteigerungen durch beliebige Preiserhöhungen, die auch im unternehmerischen Geschäftsverkehr gemäß § 307 Abs. 1 BGB unzulässig wäre[31], ist damit ausgeschlossen.
Die Preisanpassungsbestimmungen sind vorliegend auch nicht wegen des darin enthaltenen Änderungsvorbehalts gemäß § 307 Abs. 1 BGB unwirksam. Die aus § 307 Abs. 1 BGB folgende Unwirksamkeit des Änderungsvorbehaltes lässt die Wirksamkeit der Preisanpassungsbestimmungen im Übrigen unberührt.
Der ebenfalls in der Preisanpassungsklausel geregelte Änderungsvorbehalt ist gemäß § 307 Abs. 1 BGB unwirksam. Die Klausel knüpft an eine Änderung der nicht näher erläuterten Bezugskosten der Klägerin an und lässt damit bereits die Voraussetzungen und den Umfang für eine Änderung der Preisanpassungsbestimmungen in Ziffern 5.1 und 5.2 der Anlage 2 nicht hinreichend deutlich erkennen. Sie eröffnet der Klägerin damit die Möglichkeit, durch eine Änderung der in Ziffern 5.1 und 5.2 der Anlage 2 geregelten Berechnungsformeln oder der hierfür maßgeblichen Parameter einen höheren Preis zu erzielen, als ihr nach den ursprünglich vereinbarten Berechnungsformeln zusteht. Eine solche Befugnis zu einer einseitigen Verschiebung des Äquivalenzverhältnisses von Leistung und Gegenleistung ist auch im unternehmerischen Geschäftsverkehr nicht zulässig[32].
Die Unwirksamkeit dieses Änderungsvorbehalts führt allerdings nicht zur Unwirksamkeit der für die Errechnung des jeweiligen Grund- und Arbeitspreises relevanten Regelungen.
Lässt sich eine Formularklausel nach ihrem Wortlaut verständlich und sinnvoll in einen inhaltlich zulässigen und in einen unzulässigen Regelungsteil trennen, so ist die Aufrechterhaltung des zulässigen Teils nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs – vor dem Hintergrund des Verbots geltungserhaltender Reduktion – rechtlich unbedenklich[33]. Das ist hier der Fall.
Die zur Preisanpassungsberechnung enthaltenen Bestimmungen werden von der Unwirksamkeit des Änderungsvorbehalts nicht berührt. Dieser bezieht sich zwar auf eine Änderung der für die Berechnung des Grund- und Arbeitspreises maßgeblichen Vertragsbestimmungen und betrifft daher den Anwendungsbereich der Preisanpassungsbestimmungen. Der nach § 307 Abs. 1 BGB unwirksame Änderungsvorbehalt lässt sich aber durch einfaches Streichen von den AGB-rechtlich unbedenklichen Preisanpassungsbestimmungen und den ergänzenden Bestimmungen trennen. Diese Bestimmungen ändern durch die Streichung des Änderungsvorbehalts ihren Inhalt nicht und bleiben aus sich heraus verständlich und sinnvoll.
Die Berechnungsformeln sind auch nicht deshalb unwirksam, weil sie möglicherweise gegen Bestimmungen des Gesetzes über das Verbot der Verwendung von Preisklauseln bei der Bestimmung von Geldschulden – Preisklauselgesetz (PrKG)[34], verstoßen.
Es kann dahinstehen, ob es sich bei den Bestimmungen des bereits im Jahr 2003 geschlossenen Vertrages um sogenannte genehmigungsfreie Klauseln im Sinne des § 1 der bis zum 13.09.2007 geltenden Preisklauselverordnung handelt und ob gegebenenfalls die seinerzeit nach § 2 des Gesetzes über die Preisangaben in Verbindung mit den Vorschriften der Preisklauselverordnung erforderliche Genehmigung erteilt worden ist. Denn seit Inkrafttreten des Preisklauselgesetzes am 14.09.2007 richtet sich die Wirksamkeit der Klauseln nach diesem Gesetz. Das folgt aus der Überleitungsvorschrift des § 9 PrKG. Denn es ist nicht festgestellt und auch nicht ersichtlich, dass eine Genehmigung der Preisanpassungsbestimmungen in Ziffern 5.1 und 5.2 der Anlage 2 seinerzeit erteilt oder beantragt worden wäre. Nur in einem solchen Fall wären die Bestimmungen des Gesetzes über die Preisangaben und der Preisklauselverordnung auf die vorliegenden Klauseln weiter anzuwenden[35].
Dahinstehen kann aber auch, ob die Klauseln in Ziffer 5.1 und 5.2 der Anlage 2 gegen die danach maßgebliche Regelung in § 1 Abs. 1 PrKG verstoßen. Denn selbst wenn ein Verstoß vorläge, wären diese Regelungen nicht unwirksam.
Die Unwirksamkeit einer Preisklausel tritt gemäß § 8 Satz 1 PrKG erst zum Zeitpunkt der rechtskräftigen Feststellung eines Verstoßes gegen das Preisklauselgesetz ein, soweit nicht eine frühere Unwirksamkeit vereinbart ist.
Diese Voraussetzungen für eine Unwirksamkeit nach § 8 PrKG liegen hier nicht vor. Eine Preisklausel, die gegen § 1 Abs. 1 PrKG verstößt, ohne nach § 8 PrKG unwirksam zu sein, ist, wie der Bundesgerichtshof entschieden hat, auch nicht allein wegen des Verstoßes gegen § 1 Abs. 1 PrKG gemäß § 307 Abs. 1 BGB unwirksam[36].
Das Preisklauselgesetz behandelt eine gegen § 1 Abs. 1 PrKG verstoßende Klausel zunächst weiterhin als wirksam und lässt diese erst nach rechtskräftiger Feststellung des Verstoßes für die Zukunft (ex nunc) unwirksam werden (§ 8 PrKG). Wenn aber eine gegen das Preisklauselgesetz verstoßende Klausel sogar nach rechtskräftiger Feststellung des Verstoßes und dann auch nur ex nunc unwirksam sein soll, kann eine solche Klausel vor rechtskräftiger Feststellung des Verstoßes erst recht nicht gemäß § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB rückwirkend (ex tunc) unwirksam sein. Dagegen spricht auch die unterschiedliche Zielsetzung der AGB-rechtlichen Inhaltskontrolle und des Preisklauselgesetzes. Beim Preisklauselgesetz stehen stabilitäts, preis- und verbraucherpolitische Ziele im Vordergrund. Das Verbot bestimmter Preisklauseln liegt im öffentlichen Interesse am Schutz vor inflationären Tendenzen[37]. Dieser Gesichtspunkt ist bei der AGB-rechtlichen Inhaltskontrolle, bei der überprüft wird, ob die beiderseitigen Interessen im Vertrag angemessen berücksichtigt werden, nicht maßgebend[38].
Bundesgerichtshof, Urteil vom 14. Mai 2014 – VIII ZR 116/13
- Bestätigung und Fortführung von BGH, Urteil vom 14.05.2014 – VIII ZR 114/13[↩]
- BGH, Urteil vom 25.09.2013 – VIII ZR 206/12, NJW 2014, 209 Rn. 17[↩]
- BGH, Urteile vom 24.03.2010 – VIII ZR 178/08, aaO Rn.19 f., und – VIII ZR 304/08, aaO Rn. 25 f.; jeweils mwN[↩]
- BGH, Urteil vom 09.04.2013 – VIII ZR 404/12, unter – II 2 c aa mwN[↩]
- BGH, Urteile vom 09.04.2014 – VIII ZR 404/12, unter – II 2 c bb; vom 07.12 2010 – XI ZR 3/10, BGHZ 187, 360 Rn. 29; jeweils mwN[↩]
- st. Rspr.; BGH, Urteile vom 12.12 2012 – VIII ZR 14/12, NJW 2013, 926 Rn. 13; vom 07.12 2010 – XI ZR 3/10, aaO; jeweils mwN[↩]
- BGH, Urteile vom 07.12 2010 – XI ZR 3/10, aaO; vom 30.10.2002 – IV ZR 60/01, BGHZ 152, 262, 265[↩]
- BGH, Urteil vom 14.05.2014 – VIII ZR 114/13, unter – II 3 c; BGH, Urteile vom 24.03.2010 – VIII ZR 178/08, aaO Rn.19, und – VIII ZR 304/08, aaO Rn. 25; jeweils mwN[↩]
- vgl. BGH, Urteile vom 24.03.2010 – VIII ZR 178/08, aaO Rn.20, und – VIII ZR 304/08, aaO Rn. 26; jeweils mwN[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 14.05.2014 – VIII ZR 114/13, unter – II 3 c aa mwN[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 14.05.2014 – VIII ZR 114/13, unter – II 3 c bb, zu einer Preisanpassungsbestimmung mit vergleichbarer Berechnungsformel[↩]
- BGH, Urteile vom 24.03.2010 – VIII ZR 178/08, aaO Rn. 21, und – VIII ZR 304/08, aaO Rn. 29[↩]
- näher dazu BGH, Urteil vom 14.05.2014 – VIII ZR 114/13, unter – II 3 d aa mwN[↩]
- BGH, Urteil vom 14.05.2014 – VIII ZR 114/13, unter – II 3 d bb mwN[↩]
- BGH, Urteil vom 14.05.2014 – VIII ZR 114/13, aaO mwN[↩]
- BGH, Urteil vom 07.12 2010 – XI ZR 3/10, aaO Rn. 35[↩]
- BGH, Urteil vom 14.05.2014 – VIII ZR 114/13, unter – II 3 e[↩]
- BGH, Urteile vom 24.03.2010 – VIII ZR 178/08, aaO Rn. 26, und – VIII ZR 304/08, aaO Rn. 33; jeweils mwN[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 14.05.2014 – VIII ZR 114/13, unter – II 4 a, zu einer vergleichbaren Preisanpassungsbestimmung[↩]
- BGH, Urteile vom 24.03.2010 – VIII ZR 178/08, aaO, und – VIII ZR 304/08, aaO; jeweils mwN[↩]
- BGH, Urteile vom 15.07.2009 – VIII ZR 225/07, BGHZ 182, 59 Rn. 22, und – VIII ZR 56/08, BGHZ 182, 41 Rn. 22[↩]
- st. Rspr.; BGH, Urteil vom 14.05.2014 – VIII ZR 114/13, aaO unter – II 4 a aa (1) mwN[↩]
- BGH, Urteile vom 24.03.2010 – VIII ZR 178/08, aaO Rn. 30, und – VIII ZR 304/08, aaO Rn. 38[↩]
- vgl. BGH, Urteile vom 14.05.2014 – VIII ZR 114/13, unter – II 4 a bb (1); vom 24.03.2010 – VIII ZR 178/08, aaO Rn. 29, und – VIII ZR 304/08, aaO Rn. 37; jeweils zu vergleichbaren Klauseln[↩]
- BGH, Urteile vom 24.03.2010 – VIII ZR 178/08, aaO Rn. 25, 32, 36 ff., und – VIII ZR 304/08, aaO Rn. 32, 36 ff.[↩]
- BGH, Urteil vom 14.05.2014 – VIII ZR 114/13, unter – II 4 a bb (3[↩]
- BGH, Urteil vom 14.05.2014 – VIII ZR 114/13, unter – II 4 a bb (3) (b[↩]
- vgl. BGH, Urteile vom 06.07.2011 – VIII ZR 37/10, WM 2011, 1906 Rn. 36; vom 13.07.2011 – VIII ZR 339/10, WM 2011, 1910 Rn. 32; jeweils für Fernwärmeversorgungsverträge; vgl. de Wyl/Soetebeer in Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, 4. Aufl., § 11 Rn.203 und 222 ff.[↩]
- dazu BGH, Urteil vom 14.05.2014 – VIII ZR 114/13, unter – II 4 a bb[↩]
- de Wyl/Soetebeer, aaO Rn. 225[↩]
- vgl. BGH, Urteile vom 12.01.1994 – VIII ZR 165/92, BGHZ 124, 351, 361 ff.; vom 27.06.2012 – XII ZR 93/10 27[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 14.05.2014 – VIII ZR 114/13, unter – II 4 b; BGH, Urteile vom 21.09.2005 – VIII ZR 38/05, WM 2005, 2335 unter – II 3; vom 15.07.2009 – VIII ZR 225/07, aaO Rn. 26 f.; vom 28.10.2009 – VIII ZR 320/07, WM 2010, 228 Rn. 25 ff.; vom 24.03.2010 – VIII ZR 178/08, aaO Rn. 35 ff.; BGH, Beschluss vom 13.10.2009 – VIII ZR 312/08, WuM 2010, 436 Rn. 6 f.[↩]
- BGH, Urteile vom 27.09.2000 – VIII ZR 155/99, BGHZ 145, 203, 212; vom 13.01.2010 – VIII ZR 48/09, WuM 2010, 85 Rn. 13 f.[↩]
- BGBl. I 2007, 2246[↩]
- BGH, Urteile vom 13.11.2013 – XII ZR 142/12, WM 2014, 84 Rn. 24; vom 05.02.2014 – XII ZR 65/13, NJW 2014, 1300 Rn. 31[↩]
- BGH, Urteil vom 14.05.2014 – VIII ZR 114/13, unter – II 4 c[↩]
- BT-Drs. 16/4391, S. 27[↩]
- BGH, Urteil vom 14.05.2014 – VIII ZR 114/13, unter – II 4 c bb[↩]