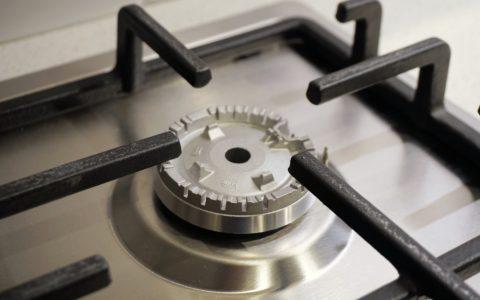Zum Verhältnis einer Festpreisvereinbarung zu einer sogenannten Wirtschaftsklausel in einem Energielieferungsvertrag hat jetzt der Bundesgerichtshof Stellung genommen:

Der dem hier entschiedenen Rechtsstreit zugrunde liegende Energielieferungsvertrag enthält als Allgemeine Geschäftsbedingung eine sogenannte Wirtschaftsklausel. Mit solchen Klauseln werden – in jeweils unterschiedlicher Ausprägung – insbesondere in längerfristigen Lieferverträgen der Industrie die Voraussetzungen eines allgemeinen Anspruchs auf Vertragsanpassung bei grundlegender Veränderung der Verhältnisse auf vertraglicher Grundlage näher geregelt[1]. Eine derartige Vertragsbestimmung hat Vorrang gegenüber der gesetzlichen Regelung über die Störung der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB).
Wirtschaftsklauseln knüpfen an die vertraglich vereinbarte Risikoverteilung an, so dass keine Anpassung erfolgt, wenn sich Risiken realisieren, die in die ausschließliche Risikosphäre nur einer der Parteien fallen[2]. Das gilt, wie das Berufungsgericht richtig gesehen hat, auch für die vorliegende Vertragsbestimmung. Denn nach ihr besteht ein Anspruch auf Vertragsanpassung nur dann, wenn einem Vertragspartner infolge grundlegender Veränderung die Beibehaltung der Vertragsbestimmungen nicht mehr zugemutet werden kann, weil die auf einen gerechten Ausgleich der beiderseitigen wirtschaftlichen Interessen abzielenden Absichten der Vertragspartner nicht mehr erfüllt werden. Diese Voraussetzung ist nicht erfüllt, wenn eine Partei nach der vertraglichen Vereinbarung das Risiko von Veränderungen in einem bestimmten Bereich zu tragen hat. Insoweit enthält die vorliegende Klausel ähnliche Kriterien wie die gesetzliche Regelung über eine Vertragsanpassung wegen Störung der Geschäftsgrundlage, die ebenfalls darauf abstellt, ob einem Teil das Festhalten am unveränderten Vertrag unter Berücksichtigung insbesondere der vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung nicht zugemutet werden kann (§ 313 Abs. 1 BGB).
Aufgrund der hier getroffenen Festpreisvereinbarung haben beide Parteien das Risiko von Veränderungen des Marktpreises für Erdgas jedenfalls solchen Ausmaßes übernommen, wie sie hier in den Jahren 2008 bis 2011 zu verzeichnen waren, und es ist ihnen deshalb zuzumuten, an der Preisvereinbarung für die auf drei Jahre begrenzte Laufzeit des Vertrages auch dann festgehalten zu werden, wenn sich der Marktpreis in dieser Zeit abweichend vom vereinbarten Preis entwickelt und sich der vereinbarte Preis damit für die eine oder andere Partei im Nachhinein als unvorteilhaft erweist. Derartige Preisschwankungen gehören hier zum unternehmerischen Risiko der davon benachteiligten Partei, das diese mit der Festpreisvereinbarung bewusst eingegangen ist. Damit besteht schon aus diesem Grund kein Anspruch der Klägerin auf Herabsetzung des vereinbarten Preises nach Ziffer 10.1 des Vertrages wegen der gefallenen Erdgaspreise. Es kann deshalb dahin gestellt bleiben, ob die nach Vertragsschluss aufgetretenen Preissenkungen auf dem Erdgasmarkt, wie das Berufungsgericht gemeint hat, angesichts der vorherigen Entwicklung der Gaspreise überhaupt zu einer – im Sinne von Ziffer 10.1 des Vertrages – grundlegenden Änderung der wirtschaftlichen Voraussetzungen, unter denen der Festpreis vereinbart wurde, geführt haben und ob der Klägerin ein Fortbestand der Festpreisvereinbarung nicht schon wegen der auf drei Jahre beschränkten Laufzeit des Vertrages zuzumuten ist.
Die Parteien haben einen Festpreis vereinbart und eine derartige Vereinbarung kann eine Risikoübernahme hinsichtlich zukünftiger Preisschwankungen auf dem Erdgasmarkt darstellen[3].
Bei der Wirtschaftsklausel handelt es sich vorliegend um eine Allgemeine Geschäftsbedingung. Die Festpreisvereinbarung hingegen war das Ergebnis monatelanger Verhandlungen und hat als Individualvereinbarung, soweit sich der Regelungsgegenstand überschneidet, Vorrang vor der Wirtschaftsklausel als einer Allgemeinen Geschäftsbedingung (§ 305b BGB). Denn individuelle Vereinbarungen bringen den Parteiwillen im konkreten Fall stärker zur Geltung als abstraktgenerelle Geschäftsbedingungen[4]. Es kommt deshalb für den Anwendungsbereich einer Allgemeinen Geschäftsbedingung auf die Reichweite und damit die Auslegung der Individualvereinbarung an und nicht umgekehrt. Aus dem Umstand, dass eine Allgemeine Geschäftsbedingung nicht geändert worden ist, kann daher keine einschränkende Auslegung einer Individualvereinbarung hergeleitet werden, wenn die konkreten Umstände des Einzelfalles – wie hier – für eine weitergehende Auslegung sprechen.
Gerade aus der Reichweite einer individuellen Preisvereinbarung ergibt sich, welcher Anwendungsbereich für eine allgemeine Wirtschaftsklausel noch verbleibt. Je nach dem von den Parteien gewählten Preismodell kann sich der Anwendungsbereich einer Wirtschaftsklausel ändern[5]. Bei einer Festpreisvereinbarung – wie hier – kommt es deshalb für den Anwendungsbereich der Wirtschaftsklausel darauf an, inwieweit die Vertragsparteien das Festpreisrisiko bewusst in Kauf genommen und dadurch eine Preisanpassung erschwert oder ausgeschlossen haben[6]. Ob und inwieweit dies der Fall ist, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalles.
Damit verwirft der Bundesgerichtshof das Argument, auf die Umstände des Vertragsschlusses, auf welche die Revisionsbegründung unbeanstandet Bezug nimmt, komme es aus Rechtsgründen nicht an, weil die Wirtschaftsklausel als Allgemeine Geschäftsbedingung objektiv auszulegen sei, trifft dies nicht zu. Der Anspruch auf Vertragsanpassung nach der Wirtschaftsklausel des Vertrages hängt (unter anderem) davon ab, ob und in welchem Umfang die Parteien im konkreten Fall das Risiko künftiger Veränderungen der Marktpreise für Erdgas übernommen haben. Das richtet sich nach der Reichweite der getroffenen Festpreisvereinbarung, für deren Auslegung die besonderen Umstände des Vertragsschlusses entscheidende Bedeutung haben.
Die Auslegung ergibt, dass der vorliegende Preisrückgang auf dem Erdgasmarkt in den Risikobereich der Klägerin fällt und diese das Risiko auch bewusst übernommen hat. Denn mit der Festpreisvereinbarung sollten, wie sich aus den Begleitumständen des Vertragsschlusses ergibt, jedenfalls Veränderungen des Marktpreises für Erdgas solchen Ausmaßes, wie sie in den Jahren 2008 bis 2011 aufgetreten sind, keinen Anspruch auf Anpassung des vereinbarten Preises rechtfertigen, und zwar weder zugunsten der Klägerin noch zugunsten der Beklagten.
Nach den Feststellungen wurden der Klägerin von der Beklagten vom Beginn der Vertragsanbahnung im Januar 2008 bis zum Vertragsschluss am 21.05.2008 diverse Angebote mit jeweils unterschiedlichen Preismodellen unterbreitet. Die Klägerin hatte die Wahl zwischen einem Festpreis, einem nach dem Öl- oder dem Aluminiumpreis indexierten Preis und einer Kombination aus Fest- und indexiertem Preis. Sie hat sich, wie das Berufungsgericht weiter festgestellt hat, nach monatelangem Bemühen um die Preisfindung, fachkundig beraten durch ein Energieberatungsunternehmen, schließlich für den angebotenen Festpreis und gegen jegliche Form von Indexierung entschieden. Daran hat sie auch nach Vertragsschluss noch festgehalten, als die Parteien im Juni 2008 nochmals über das Preismodell miteinander sprachen.
Hintergrund dieser – von der Beklagten akzeptierten – Entscheidung für einen Festpreis war ersichtlich die auch vom Berufungsgericht angesprochene und der Beklagten bekannte Zielvorstellung der Klägerin, mit dem Festpreis den sichersten Weg für kommende Unwägbarkeiten der Entwicklung des Gaspreises zu wählen. Denn in den fast vier Monaten der Vertragsverhandlungen vom Zeitpunkt der Ausschreibung und dem ersten Angebot der Beklagten im Januar 2008 an bis zum Vertragsschluss am 21.05.2008 waren die Durchschnittspreise für JahresGasFutures am Warenterminmarkt, an denen sich die Parteien bei der Preisfindung orientierten, unstreitig von rund 24 € auf 35,77 € pro Megawattstunde, das heißt um etwa 47 %, gestiegen. Dieser enorme Preisanstieg hatte bereits früher eingesetzt. Im Oktober 2007 lag der Preis noch bei 21,02 €; daraus ergibt sich eine Preissteigerung in den acht Monaten vor Vertragsschluss um ungefähr 70 %. Auf diese der Klägerin bekannte Entwicklung hatte die Beklagte am Tag des Vertragsschlusses nochmals hingewiesen. In ihrem Schreiben vom 21.05.2008 heißt es: „During our meeting in Stade on May, 14th 2008 you asked us to offer today binding power and gas supply prices for the future as long as it is currently possible with reference to wellknown energy price developments of the last weeks and months. Against the background of the price developments you decided not to lose valuable time and hedge a maximum volume very short term – i.e. today. This model has been discussed with our management and is supported by them taking in consideration the current market situation.”
Wenn sich die Klägerin auf der Grundlage des von ihr geäußerten Wunsches, sich angesichts der vorangegangenen Entwicklung der Gaspreise kurzfristig für eine möglichst lange Zeit ein maximales Liefervolumen zu sichern, für einen Festpreis bei dreijähriger Laufzeit und gegen einen – alternativ angebotenen – vollständig oder hälftig indexierten Preis entschied, so liegt auf der Hand, dass die Klägerin dies mit dem Ziel tat, während der Vertragsdauer gegen etwaige weitere Preissteigerungen in der Größenordnung der vorangegangenen Monate abgesichert zu sein. Diese auch für die Beklagte offen zutage liegende Zielvorstellung der Klägerin ist damit Vertragsinhalt der Festpreisvereinbarung geworden, so dass es der Beklagten verwehrt gewesen wäre, im Falle weiterer – auch erheblicher – Steigerungen der Durchschnittspreise für JahresGasFutures eine Preiserhöhung unter Berufung auf die allgemeine Wirtschaftsklausel – und damit entgegen der vorrangigen Individualvereinbarung – zu beanspruchen.
Für den vorliegenden Fall gesunkener Preise gilt nichts anderes. Zwar hat die Klägerin beim Abschluss der Festpreisvereinbarung möglicherweise nicht mit sinkenden Preisen gerechnet. Sie übernahm aber mit der Festpreisvereinbarung, mit der sie angesichts der Gefahr weiterer Preissteigerungen ihr Interesse an einem stabilen Vertragspreis wahrte, das Risiko, dass sich der vereinbarte Festpreis im Falle sinkender Marktpreise im Nachhinein als ungünstiger erweist als der von der Beklagten alternativ angebotene – von der Klägerin aber abgelehnte – indexierte Preis. Das folgt aus dem Gebot beiderseits interessengerechter Auslegung von Verträgen.
Für die Beklagte bedeutete der mit der Festpreisvereinbarung verbundene Verzicht auf eine Preisanpassung an die Marktentwicklung während der dreijährigen Laufzeit des Vertrages, dass sie im Fall weiter steigender Marktpreise Gewinneinbußen hinzunehmen hatte. Sie übernahm dadurch das Risiko, das Erdgas bei steigenden Preisen möglicherweise unter dem jeweiligen Marktpreis liefern zu müssen. Die Klägerin konnte billigerweise nicht erwarten, dass die Beklagte auf eine Erhöhung des vereinbarten Preises bei steigenden Marktpreisen verzichtet, umgekehrt aber der Klägerin eine Preissenkung bei fallenden Marktpreisen zugutekommen lässt. Vielmehr durfte die Beklagte davon ausgehen, dass die Klägerin aufgrund der getroffenen Festpreisvereinbarung das Risiko sinkender Marktpreise in gleichem Umfang zu tragen hat wie die Beklagte das Risiko steigender Preise. Das bedeutet, dass die Klägerin bei interessengerechter Auslegung der Festpreisvereinbarung jedenfalls ein Zurückfallen des Marktpreises auf den Stand von Januar 2008, als die Verhandlungen der Parteien begannen, hinzunehmen hat, ohne unter Berufung auf die allgemeine Wirtschaftsklausel in Ziffer 10.1 des Vertrages eine Herabsetzung des vereinbarten Preises beanspruchen zu können.
Soweit dagegen die Klägerin auf die gefallenen Preisen für Aluminium, Aluminiumhydroxid und Aluminiumoxid verweist und dadurch den Tatbestand der Wirtschaftsklausel als erfüllt ansieht, rechtfertigt dies keine andere Beurteilung. Durch den Verzicht auf einen – von der Beklagten ebenfalls angebotenen – nach dem Aluminiumpreis indexierten Preis hat die Klägerin auch das Risiko übernommen, dass sich das Verhältnis zwischen dem von ihr zu zahlenden Gaspreis und den Aluminiumpreisen zu ihren Ungunsten verschiebt. Es liegt in ihrem Risikobereich als Industrieunternehmen, ob sie mit dem fest vereinbarten Erdgaspreis für den Aluminiummarkt rentabel produzieren konnte.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 23. Januar 2013 – VIII ZR 47/12
- vgl. BGH, Urteil vom 11.10.1978 – VIII ZR 110/77, WM 1978, 1389 zu einer „Wirtschaftlichkeitsklausel“ und deren Verhältnis zu einer daneben vereinbarten Preisänderungsklausel in einem Stromversorgungsvertrag[↩]
- Büttner/Däuper, ZNER 2003, 205, 207; Büdenbender in Festschrift Baur, 2002, S. 415, 420; Baur in Festschrift Steindorff, 1990, S. 509, 515[↩]
- vgl. BGH, Urteile vom 06.04.1995 – IX ZR 61/94, BGHZ 129, 236, 253 mwN; BGH, Urteil vom 08.02.1978 – VIII ZR 221/76, WM 1978, 322 unter II 2 a[↩]
- vgl. Berger in Prütting/Wegen/Weinreich, BGB, 7. Aufl., § 305b Rn. 1[↩]
- vgl. Harms, DB 1983, 322, 326; Büdenbender, aaO S. 417; Kunth, BB 1978, 178, 181[↩]
- Kunth, aaO; Lettl, JuS 2001, 347, 352[↩]