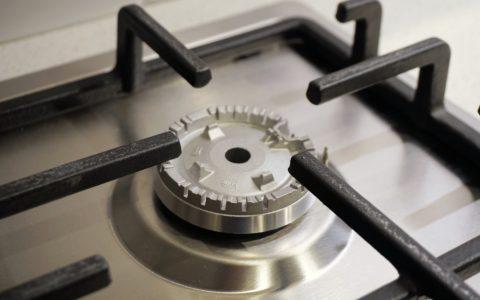Anders als bei Haushaltskunden steht dem Gasgrundversorger gegenüber Nicht-Haushaltskunden im Sinne des Art. 2 Nr. 26 der Gas-Richtlinie 2003/55/EG, die auch nicht gemäß § 3 Nr. 22 Alt. 2 EnWG 2005 als Haushaltskunden anzusehen sind, gemäß § 4 Abs. 1 und 2 AVBGasV auch nach dem Ablauf der bis zum 1.07.2004 reichenden Umsetzungsfrist der Gas-Richtlinie 2003/55/EG das Recht zu, die Preise nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) zu ändern[1].

Diesem Preisänderungsrecht stehen die Transparenzanforderungen des Art. 3 Abs. 3 in Verbindung mit Anhang A der Gas-Richtlinie 2003/55/EG in der durch den Gerichtshof der Europäischen Union im Urteil vom 23.10.2014[2] vorgenommenen Auslegung nicht entgegen, da die Gas-Richtlinie deren Anwendung für Nicht-Haushaltskunden nicht zwingend vorschreibt.
Eine unter diesen Voraussetzungen vom Gasgrundversorger einseitig gemäß § 4 Abs. 1, 2 AVBGasV vorgenommene Preiserhöhung unterliegt auch dann der Billigkeitskontrolle nach § 315 BGB, wenn für den Kunden die Möglichkeit besteht, das Erdgas von einem anderen Anbieter zu beziehen.
Die Billigkeitskontrolle solcher Preiserhöhungen (§ 315 BGB) kann nicht entscheidend auf der Grundlage eines Vergleichs mit den Gaspreisen anderer Gasversorgungsunternehmen vorgenommen werden; vielmehr kommt es maßgeblich auf den konkreten Gaslieferungsvertrag an und ist eine umfassende Würdigung des Vertragszwecks sowie der Interessenlage beider Parteien vorzunehmen[3].
Als eine zur Beendigung der von § 116 Satz 1 EnWG 2005 angeordneten Fortgeltung des alten Rechts für Tarifkundenverträge mit Nicht-Haushaltskunden führende Änderung des Vertrages im Sinne des § 116 Satz 2 EnWG 2005 ist nicht schon eine vom Gasgrundversorger einseitig vorgenommene Änderung der allgemeinen Tarife und Bedingungen anzusehen; es bedarf wegen der mit der Vertragsänderung nach § 116 Satz 2 EnWG 2005 insoweit verbundenen Beendigung der Grundversorgung vielmehr eines übereinstimmenden Änderungswillens der Parteien.
In dem hier vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall war im Rahmen des Umzugs des Gaskunden der bisherige Gaslieferungsvertrag der Parteien beendet und konkludent durch Gasentnahme in den neuen Geschäftsräumen des Gaskunden ab dem 1.07.2003 ein neuer Gaslieferungsvertrag in Gestalt eines Tarifkundenvertrages zwischen den Parteien zustande gekommen ist. Zutreffend ist auch die Annahme des Landgerichts Gießen[4], dass es sich bei dem Gaskunden um einen Nicht-Haushaltskunden handelt und der Gasversorgerin daher ein Recht zur Preisänderung nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) gemäß § 4 Abs. 1 und 2 AVBGasV auch für den Zeitraum nach dem Inkrafttreten des EnWG 2005 und der GasGVV zustand (§ 116 EnWG 2005). Diesem Preisänderungsrecht stehen die Transparenzanforderungen des Art. 3 Abs. 3 in Verbindung mit Anhang A der Gas-Richtlinie 2003/55/EG (im Folgenden: Gas-Richtlinie) nicht entgegen, da die Gas-Richtlinie diese nur für Haushaltskunden, nicht jedoch für – wie hier – Nicht-Haushaltskunden zwingend vorschreibt.
Da § 4 Abs. 1, 2 AVBGasV mithin die Grundlage der von der Gasversorgerin hier vorgenommenen Preiserhöhungen ist, kommt es, wie das Landgericht Gießen[4] im Ausgangspunkt zutreffend angenommen hat, auf deren Billigkeit nach § 315 BGB an. Mit der vom Landgericht Gießen[4] gegebenen Begründung kann jedoch die Billigkeit der von ihm geprüften Preiserhöhungen der Gasversorgerin zum 1.10.2008 und zum 1.01.2010 nicht bejaht und demzufolge ein Anspruch der Gasversorgerin auf Zahlung restlichen Entgelts (§ 433 Abs. 2 BGB) in Höhe von 1.521, 70 € nebst Zinsen nicht zuerkannt werden. Auch kann mit dieser Begründung die Billigkeit der vor dem 1.10.2008 erfolgten Preisänderungen der Gasversorgerin, denen der Gaskunde ebenfalls rechtzeitig widersprochen hat, nicht für unerheblich erachtet werden.
Das Landgericht Gießen[4] hat allerdings ohne Rechtsfehler angenommen, dass die Parteien im Rahmen des Umzugs des Gaskunden das ursprünglich zwischen ihnen bestehende Vertragsverhältnis zum 10.09.2003 beendet und durch die seitens des Gaskunden ab dem 1.07.2003 in dessen neuen Geschäftsräumen erfolgte Gasentnahme konkludent einen ab diesem Zeitpunkt geltenden neuen Gaslieferungsvertrag in Gestalt eines Tarifkundenvertrages mit einem Nicht-Haushaltskunden geschlossen haben.
Dabei kann dahingestellt bleiben, ob es sich bei dem ursprünglichen Gaslieferungsvertrag der Parteien aus dem Jahre 1989 um einen Sonderkundenvertrag handelte, woraus die Kundin herleiten will, dass die Parteien dieses Vertragsverhältnis durch den Gasverbrauch in den neuen Geschäftsräumen fortgesetzt hätten. Denn nach den Feststellungen des Landgerichts Gießen[4] ist der ursprüngliche Gaslieferungsvertrag von den Parteien einvernehmlich beendet worden.
Das Landgericht Gießen[4] hat im Rahmen der von ihm vorgenommenen Gesamtwürdigung des Schriftwechsels und des sonstigen Verhaltens der Parteien entscheidend darauf abgestellt, dass die Gasversorgerin dem Gaskunden, nachdem dieser ihr den Umzug in die neuen Geschäftsräume angezeigt hatte, eine Schlussrechnung hinsichtlich der bisherigen Geschäftsräume erstellt und ihm eine Vertragsbestätigung mit anderer Kundennummer für die neuen Geschäftsräume übersandt hat. Soweit das Landgericht Gießen[4] namentlich aufgrund dieser Umstände und unter zusätzlicher Berücksichtigung der örtlichen Gepflogenheiten den ursprünglichen Vertrag als beendet angesehen hat, lässt dies einen Rechtsfehler nicht erkennen.
Ebenfalls frei von Rechtsfehlern ist die Annahme des Landgerichts Gießen[4], durch die Entnahme von Gas in den neuen Geschäftsräumen des Gaskunden sei zwischen den Parteien konkludent ein neuer Gaslieferungsvertrag zustande gekommen.
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist in dem Leistungsangebot eines Versorgungsunternehmens grundsätzlich ein Vertragsangebot zum Abschluss eines Versorgungsvertrags in Form einer sogenannten Realofferte zu sehen. Diese wird von demjenigen konkludent angenommen, der aus dem Leitungsnetz des Versorgungsunternehmens Elektrizität, Gas, Wasser oder Fernwärme entnimmt[5].
Diese vom Landgericht Gießen[4] zutreffend herangezogenen Grundsätze bezweifelt auch die Gaskundin nicht. Sie meint jedoch, vom konkludenten Abschluss eines neuen Gaslieferungsvertrages sei dann nicht auszugehen, wenn zwischen den Vertragsparteien bereits ein ungekündigtes Vertragsverhältnis bestehe, auf dessen Grundlage die betreffenden Versorgungsleistungen erbracht würden. Dieser Einwand greift indes nicht durch.
Zwar hat der Bundesgerichtshof in seinem Urteil vom 28.03.2007[6], dem die Fallgestaltung zugrunde lag, dass der Versorger nach einem Kundenwiderspruch den alten Tarif kündigen und den Kunden zu einem anderen Tarif versorgen wollte, ausgeführt, die oben genannten Grundsätze des konkludenten Abschlusses eines Versorgungsvertrages durch die Entnahme von Energie gälten nicht, wenn zwischen den Parteien bereits ein ungekündigtes Vertragsverhältnis bestehe, auf dessen Grundlage die betreffenden Versorgungsleistungen erbracht würden; in diesem Fall komme der weiteren Abnahme von Energie keine Erklärungsbedeutung zu.
Auch hat der Bundesgerichtshof in einem weiteren Urteil vom 06.07.2011[7], in dem es um den Strombezug über einen anderen im selben Haus befindlichen Stromzähler ging, ausgeführt, die oben genannten Grundsätze gälten nicht uneingeschränkt, wenn zwischen dem Abnehmer oder zwischen dem Versorgungsunternehmen und einem Dritten schon eine Energieliefervereinbarung bestehe.
Anders als im Streitfall fand jedoch in den vorbezeichneten Fällen ein Wechsel der zu versorgenden Räumlichkeiten nicht statt. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob ein Energieversorgungsvertrag typischerweise für den Bezug von Energie für eine bestimmte Verbrauchsstelle geschlossen wird[8]. Denn jedenfalls in der Gesamtschau des im Streitfall erfolgten Wechsels der zu versorgenden Räumlichkeiten und der vom Landgericht Gießen[4] darüber hinaus festgestellten, oben bereits erwähnten Einzelfallumstände begegnet die Annahme des Abschlusses eines neuen Gaslieferungsvertrages hier keinen rechtlichen Bedenken.
Gegen die Fortführung des ursprünglichen Vertrages in den neuen Geschäftsräumen spricht schließlich auch der Umstand, dass der alte Vertrag bezüglich des Gasbezugs in den früheren Geschäftsräumen zunächst noch fortgesetzt und nach den Feststellungen des Landgerichts Gießen[4] erst zum 10.09.2003 und damit mehr als zwei Monate nach Beginn des Gasbezugs in den neuen Geschäftsräumen beendet wurde. Gegenstand eines solchen Vertrages wären daher jedenfalls zeitweise zwei Verbrauchsstellen gewesen. Anhaltspunkte für einen dahingehenden Willen der Parteien lassen sich den Feststellungen des Landgerichts Gießen[4] aber nicht entnehmen.
Auch ist die Annahme des Landgerichts Gießen[4], bei dem neuen Gaslieferungsvertrag der Parteien handele es sich um einen Tarifkundenvertrag, rechtlich nicht zu beanstanden.
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kommt es für die Frage, ob es sich bei öffentlich bekannt gemachten Vertragsmustern und Preisen um Tarif- beziehungsweise Grundversorgungsverträge mit allgemeinen Tarifpreisen im Sinne von § 6 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes („EnWiG 1935“)[9], Allgemeinen Tarifen im Sinne von § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes vom 24.04.1998[10] („EnWG 1998“) oder Allgemeinen Preisen im Sinne von § 36 Abs. 1, § 39 Abs. 1 des Gesetzes über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz – EnWG) vom 07.07.2005[11] („EnWG 2005“) handelt, darauf an, ob das betreffende Versorgungsunternehmen die Versorgung zu den öffentlich bekannt gemachten Bedingungen und Preisen – aus der Sicht eines durchschnittlichen Abnehmers – im Rahmen einer Versorgungspflicht nach den genannten Vorschriften oder unabhängig davon im Rahmen der allgemeinen Vertragsfreiheit anbietet[12]. Ersteres ist hier der Fall.
Wie das Landgericht Gießen[4] ebenfalls zutreffend erkannt hat, steht es nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs einem Energieversorgungsunternehmen auch im Rahmen der Grundversorgung frei, verschiedene Tarife – wie hier der Fall – anzubieten[13].
Dass es sich bei dem Gaskunden vorliegend um einen Nicht-Haushaltskunden im Sinne des Art. 2 Nr. 26 der Gas-Richtlinie handelt, da er das Erdgas für andere Zwecke als den Eigenverbrauch im Haushalt gekauft hat, steht der Annahme eines Tarifkundenvertrages ebenfalls nicht entgegen. Denn die zum Zeitpunkt des Abschlusses des neuen Gaslieferungsvertrages der Parteien geltenden Bestimmungen in § 10 Abs. 1 Satz 1 EnWG 1998 und § 1 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Gasversorgung von Tarifkunden vom 21.06.1979[14] sahen – anders als die Nachfolgeregelungen in § 36 Abs. 1 Satz 1 EnWG 2005 und § 1 Abs. 1 und 2 der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz (Gasgrundversorgungsverordnung – GasGVV) vom 26.10.2006[15] – eine allgemeine Anschluss- und Versorgungspflicht zu den öffentlich bekanntgegebenen Allgemeinen Tarifen für „jedermann“, mithin auch für Nicht-Haushaltskunden – wie den Gaskunden – vor[16].
Bei der Auslegung eines Vertrages kann auch das nachträgliche Verhalten der Vertragsparteien Berücksichtigung finden (§§ 133, 157 BGB). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann bei der Auslegung von Verträgen auch das nachträgliche Verhalten der Vertragsparteien zu berücksichtigen sein. Dieses kann zwar den objektiven Vertragsinhalt nicht mehr beeinflussen, aber Bedeutung für die Ermittlung des tatsächlichen Willens und das tatsächliche Verständnis der Vertragsparteien haben[17].
Das Landgericht Gießen[4] hat dementsprechend zu Recht das Schreiben der Gasversorgerin vom 14.12 2004 in seine Auslegung des Gaslieferungsvertrages der Parteien einbezogen. Die Rüge der Gaskundin, das Landgericht Gießen[4] hätte aufgrund des vorbezeichneten Inhalts dieses Schreibens zu der Beurteilung gelangen müssen, dass es sich bei dem Vertragsverhältnis der Parteien um einen (Norm-)Sonderkundenvertrag handele, geht fehl.
Die Gaskundin verkennt bereits im Ausgangspunkt, dass es bei der hier vorliegenden Art des Vertragsabschlusses in Gestalt einer seitens des Kunden durch die Entnahme von Gas konkludent angenommenen Realofferte des Gasgrundversorgers – auch mit Blick auf den Massengeschäftscharakter derartiger Verträge – entscheidend auf den objektiven Inhalt dieser beiden konkludenten Willenserklärungen, nicht hingegen auf etwaige entgegenstehende Äußerungen ankommt[18]. Dementsprechend bestimmt sich auch der Inhalt eines solchen Gaslieferungsvertrages, wie oben bereits erwähnt, nach dem Verständnis des durchschnittlichen Abnehmers auf der Grundlage der veröffentlichten Allgemeinen Tarife des Gasversorgers. Dies führt hier nach der rechtsfehlerfreien Würdigung des Landgerichts Gießen[4] zu der Annahme eines Tarifkundenvertrages.
Mit ihrer gegenteiligen Auffassung lässt die Gaskundin zudem außer Acht, dass unabhängig von den vorbezeichneten Grundsätzen ein sich aus einem nachträglichen Verhalten der Parteien ergebendes Indiz voraussetzte, dass dieses Rückschlüsse auf den übereinstimmenden Willen der Parteien bei Vertragsschluss zuließe[19]. Die hier im Schreiben der Gasversorgerin enthaltene – vereinzelt gebliebene und nur einseitig erfolgte – nachträgliche Bezeichnung des Vertragsverhältnisses der Parteien als Sondervertrag erfüllt diese Voraussetzung schon deshalb nicht, weil sie nach den rechtsfehlerfreien, auf der Grundlage einer Gesamtwürdigung des Verhaltens der Parteien getroffenen Feststellungen des Landgerichts Gießen[4] lediglich auf einem Irrtum der Gasversorgerin beruhte.
Im Übrigen verkennt die Gaskundin, dass selbst eine – hier nicht gegebene – übereinstimmende Vertragsbezeichnung durch die Parteien nicht ausschlaggebend für den rechtlichen Inhalt des Vertrages wäre, wenn andere Umstände, wie hier insbesondere die Beendigung des auf die früheren Geschäftsräume des Gaskunden bezogenen Gaslieferungsvertrages und die auf der Grundlage der veröffentlichten allgemeinen Tarife der Gasversorgerin erfolgte Gasentnahme durch den Gaskunden in dessen neuen Geschäftsräumen, für einen anderen Vertragstyp sprechen. Maßgeblich kommt es, wie das Landgericht Gießen[4] zutreffend angenommen hat, darauf an, welchem gesetzlichen Vertragstyp – hier einem Tarifkundenvertrag gemäß den Vorschriften der § 10 Abs. 1, § 11 Abs. 1 EnWG 1998 und der AVBGasV – ein Vertrag seinem Inhalt nach zuzuordnen ist[20].
Bereits aus den vorstehend genannten Gründen bleibt auch die Rüge der Gaskundin ohne Erfolg, für das Bestehen eines Sonderkundenvertrages spreche (auch) der Inhalt des im August 2008 verfassten – vom Landgericht Gießen[4] nicht ausdrücklich erwähnten – Schreibens der Gasversorgerin, in welchem diese im Rahmen der Ankündigung einer Preiserhöhung die Bezeichnung „Sonderpreisregelung Heizung“ verwendete. Mit ihrer gegenteiligen Auffassung übersieht die Gaskundin zudem, dass diese Bezeichnung ersichtlich im Zusammenhang mit der nach den Feststellungen des Landgerichts Gießen[4] auch in den veröffentlichten Preisänderungsankündigungen der Gasversorgerin im Rahmen ihrer Allgemeinen Tarife enthaltenen Unterscheidung zwischen Allgemeinen Tarifpreisen für Erdgas und Sonderpreisen für Heizgas steht, welche das Landgericht Gießen[4] in seine Würdigung des Vertragstyps einbezogen und unter Berücksichtigung des Gesamtinhalts der von der Gasversorgerin veröffentlichten Tarife sowie der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs rechtsfehlerfrei als einen der Annahme eines Tarifkundenvertrages nicht entgegenstehenden Umstand angesehen hat.
Schließlich haben die Parteien den Gaslieferungsvertrag nach dessen Abschluss auch nicht einvernehmlich von einem Tarifkundenvertrag in einen (Norm-)Sonderkundenvertrag geändert[21].
Im Rahmen des somit hinsichtlich der neuen Geschäftsräume des Gaskunden ab dem 1.07.2003 bestehenden Tarifkundenvertrages, stand der Gasversorgerin gemäß dem hier nach § 116 EnWG 2005 auch über den Zeitpunkt des Inkrafttretens des EnWG 2005 und der GasGVV hinaus bis zum Ende dieses Vertragsverhältnisses der Parteien anzuwendenden § 4 Abs. 1 und 2 AVBGasV das Recht zu, die Preise nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) zu ändern. Die Transparenzanforderungen des Art. 3 Abs. 3 Satz 4 bis 6 in Verbindung mit Anhang A der Gas-Richtlinie in der durch den Gerichtshof im Urteil vom 23.10.2014[22] vorgenommenen Auslegung stehen diesem Preisänderungsrecht der Gasversorgerin nicht entgegen, da es sich bei dem Gaskunden, wie oben ausgeführt, anders als in den vom Bundesgerichtshof im Anschluss an das vorgenannte Urteil des Gerichtshofs durch die Urteile vom 28.10.2015[23] entschiedenen Fällen, die jeweils Haushaltskunden betrafen, um einen Nicht-Haushaltskunden im Sinne des Art. 2 Nr. 26 der Gas-Richtlinie handelt. Für diesen Kundenkreis schreibt die Gas-Richtlinie eine Anwendung der genannten Transparenzanforderungen nicht zwingend vor, und der nationale Gesetz- und Verordnungsgeber hat diesen Kundenkreis lediglich bis zu einem – hier überschrittenen – Jahresverbrauch von 10.000 Kilowattstunden als Haushaltskunden eingestuft (§ 3 Nr. 22 EnWG 2005).
Das Landgericht Gießen[4] hat – wenn auch ohne Begründung – im Ergebnis zutreffend angenommen, dass auf das am 1.07.2003 begonnene Vertragsverhältnis der Parteien durchgängig bis zu dessen Beendigung im Sommer des Jahres 2010 die Vorschriften des EnWG 1998 und der AVBGasV – und damit auch die vorgenannte Bestimmung des § 4 Abs. 1 und 2 AVBGasV – Anwendung finden.
Gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 der aufgrund der Ermächtigungsgrundlage in § 11 Abs. 2 EnWG erlassenen AVBGasV sind deren Regelungen kraft dieser Rechtsverordnung zwingend Bestandteil des Versorgungsvertrages[24]. Dies gilt – wie oben ausgeführt – im hier maßgeblichen Zeitraum auch für Tarifkundenverträge (Grundversorgungsverträge) mit Nicht-Haushaltskunden.
Die Übergangsregelung in § 115 Abs. 2 des am 13.07.2005 in Kraft getretenen EnWG 2005 sieht in Bezug auf zu diesem Zeitpunkt bestehende Verträge über die Belieferung von Letztverbrauchern (§ 3 Nr. 25 EnWG) mit Energie im Rahmen der allgemeinen Versorgungspflicht – mithin für Tarifkundenverträge (Grundversorgungsverträge) – grundsätzlich vor, dass Verträge mit einer Laufzeit bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes unberührt bleiben (§ 115 Abs. 2 Satz 1 EnWG 2005). Hingegen sind bestehende Verträge mit einer längeren Laufzeit – mithin auch ein, wie hier, unbefristeter Vertrag – spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten einer zu diesem Gesetz nach § 39 oder § 41 EnWG 2005 erlassenen Rechtsverordnung – hier der am 8.11.2006 in Kraft getretenen GasGVV – an die jeweils entsprechenden Vorschriften dieses Gesetzes und die jeweilige Rechtsverordnung nach Maßgabe dieser Rechtsverordnung anzupassen (§ 115 Abs. 2 Satz 3 EnWG 2005; vgl. auch BGH, Urteil vom 15.12 2015 – EnZR 65/14 28). § 23 GasGVV sieht hierzu eine entsprechende Übergangsregelung vor.
§ 116 EnWG 2005 trifft indessen für Nicht-Haushaltskunden, mit denen ein Tarifkundenvertrag besteht, eine gegenüber den vorbezeichneten Grundsätzen speziellere Übergangsregelung[25]. Diese ist erforderlich, da § 36 Abs. 1 Satz 1 EnWG 2005 und § 1 Abs. 1 und 2 GasGVV eine Grundversorgung – anders als nach der bis dahin geltenden Rechtslage des EnWG 1998 und der AVBGasV – nur noch für Haushaltskunden vorsehen und daher die in § 115 Abs. 2 Satz 3 EnWG 2005 für länger laufende Tarifkundenverträge grundsätzlich vorgesehene Überleitung in Grundversorgungsverträge nach neuem Recht für Tarifkundenverträge mit Nicht-Haushaltskunden nicht möglich ist[26].
Um die Fortgeltung solcher Verträge über das Inkrafttreten des EnWG 2005 hinaus zu ermöglichen[27], bestimmt § 116 Satz 1 EnWG 2005, dass unbeschadet des § 115 EnWG 2005 die §§ 10 und 11 EnWG 1998 sowie die AVBGasV auf bestehende Tarifkundenverträge, die nicht mit Haushaltskunden im Sinne dieses Gesetzes abgeschlossen worden sind, bis zur Beendigung der bestehenden Verträge weiter anzuwenden sind. Lediglich bei Änderungen dieser Verträge und bei deren Neuabschluss sollen gemäß § 116 Satz 2 EnWG 2005 die Bestimmungen des EnWG 2005 und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen GasGVV gelten.
Wie das Landgericht Gießen[4] im Ergebnis zutreffend angenommen hat, sind im Streitfall die Voraussetzungen des § 116 Satz 1 EnWG 2005 erfüllt und daher, da nach den Feststellungen des Landgerichts Gießen[4] weder ein Neuabschluss noch eine Änderung des Gaslieferungsvertrages im Sinne des § 116 Satz 2 EnWG 2005 erfolgt ist, die §§ 10 und 11 EnWG 1998 sowie die Bestimmungen der AVBGasV auf das Vertragsverhältnis der Parteien bis zu dessen Beendigung im Sommer 2010 weiter anzuwenden.
Bei dem Gaskunden handelt es sich nicht um einen Haushaltskunden im Sinne des EnWG 2005.
Nach der Legaldefinition in § 3 Nr. 22 EnWG 2005 sind Haushaltskunden Letztverbraucher (§ 3 Nr. 25 EnWG 2005), die Energie überwiegend für den Eigenverbrauch im Haushalt oder für den einen Jahresverbrauch von 10.000 Kilowattstunden nicht übersteigenden Eigenverbrauch für berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke kaufen. Der Gesetzgeber hat damit von der ihm durch Art. 3 Abs. 3 Satz 1 der Strom-Richtlinie 2003/55/EG eröffneten Möglichkeit Gebrauch gemacht, den Begriff des Haushaltskunden weiter als nach der in dieser Richtlinie und in der Gas-Richtlinie enthaltenen Definition zu fassen und auf diese Weise auch Kleinunternehmen in die Grundversorgung einzubeziehen[28].
Das Landgericht Gießen[4] hat die Voraussetzungen des § 116 Satz 1 EnWG als erfüllt angesehen und ist damit unausgesprochen und im Ergebnis rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, dass der Gaskunde, den es – wie oben erwähnt – in anderem Zusammenhang zutreffend als Nicht-Haushaltskunden im Sinne des Art. 2 Nr. 26 der Gas-Richtlinie eingestuft hat, auch kein Haushaltskunde im Sinne des § 3 Nr. 22 EnWG 2005 ist. Der Gaskunde hat zwar das von der Gasversorgerin bezogene Erdgas gemäß den Feststellungen des Landgerichts Gießen[4] für den Eigenverbrauch gekauft. Bei diesem Eigenverbrauch handelte es sich indes weder um einen solchen im Haushalt noch um einen für berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke innerhalb der oben genannten Jahresverbrauchsgrenze von bis zu 10.000 Kilowattstunden.
Eigenverbrauch im Haushalt gemäß § 3 Nr. 22 EnWG ist der Energieverbrauch für eigene private Zwecke in einem Haushalt. Dabei ist unter einem Haushalt im Sinne der vorbezeichneten Bestimmung die räumliche und wirtschaftliche Einheit zu verstehen, die unabhängig vom Lebensstandard der Haushaltsangehörigen Grundlage und Mittelpunkt des privaten täglichen Lebens ist[29]. Diese Voraussetzungen sind hier nicht erfüllt, da der Gaskunde das Erdgas für seine Geschäftsräume bezog, in denen er seiner Tätigkeit als Mieterverein nachgeht.
Der Gaskunde hat damit das von der Gasversorgerin bezogene Erdgas für berufliche beziehungsweise gewerbliche Zwecke gekauft. Nach den Feststellungen des Landgerichts Gießen[4] fehlt es jedoch an der für die Annahme einer Haushaltskundeneigenschaft insoweit erforderlichen weiteren Voraussetzung eines Jahresverbrauchs, der die in § 3 Nr. 22 EnWG 2005 genannte Grenze von 10.000 Kilowattstunden nicht übersteigt. Das Landgericht Gießen[4] hat zwar ausdrückliche Feststellungen zum Jahresverbrauch des Gaskunden nicht getroffen. Jedoch ergibt sich aus dem Inhalt der im Berufungsurteil genannten Jahresabrechnungen der Gasversorgerin, die das Landgericht Gießen[4] seinen Feststellungen zugrunde gelegt hat, dass der Erdgas-Jahresverbrauch des Gaskunden bei Inkrafttreten des EnWG 2005 und auch sonst bei über 30.000 Kilowattstunden jährlich und damit deutlich über der vorgenannten Grenze des § 3 Nr. 22 EnWG von 10.000 Kilowattstunden pro Jahr lag.
Der somit gemäß § 116 Satz 1 EnWG anzunehmenden Fortgeltung der §§ 10 und 11 EnWG 1998 sowie der Bestimmungen der AVBGasV auf das Vertragsverhältnis der Parteien bis zu dessen Beendigung steht die in § 116 Satz 2 EnWG enthaltene Ausnahmeregelung nicht entgegen. Denn nach den Feststellungen des Landgerichts Gießen[4] ist weder ein Neuabschluss des Gaslieferungsvertrages der Parteien erfolgt noch hat bis zu dessen Beendigung im Sommer 2010 eine Änderung im Sinne des § 116 Satz 2 EnWG stattgefunden.
Allerdings stellt nach der in der Literatur ganz überwiegend vertretenen Auffassung bereits jede Preisänderung, mithin auch eine vom Gasversorger – wie hier von der Gasversorgerin – einseitig vorgenommene Änderung der allgemeinen Tarife und Bedingungen gemäß dem im Vertragsverhältnis mit Nicht-Haushaltskunden fortgeltenden § 4 Abs. 1, 2 AVBGasV, eine Änderung des Vertrages im Sinne des § 116 Satz 2 EnWG 2005 dar[30]. Diese Auffassung vermag indes nicht zu überzeugen, soweit sie auch eine vom Gasversorger einseitig vorgenommene Preisänderung als Vertragsänderung im Sinne des § 116 Satz 2 EnWG 2005 ansieht.
Zwar spricht der Wortlaut dieser Bestimmung nicht gegen die vorbezeichnete Auffassung. Auch lässt sich den Gesetzesmaterialien nicht entnehmen, ob der Gesetzgeber bei der Schaffung des § 116 Satz 2 EnWG unter dem Begriff der Änderung des Vertrages auch eine einseitig vorgenommene (wirksame) Preisänderung verstanden hat. In der Einzelbegründung zu § 116 EnWG 2005 wird lediglich ausgeführt:
„Die Vorschrift stellt klar, dass bisherige Tarifkundenverträge, die nicht mehr von der Grundversorgungspflicht nach § 36 [EnWG 2005] erfasst werden, unberührt bleiben.“[31]
Es ergibt sich jedoch aus der Gesetzessystematik sowie aus dem Sinn und Zweck des § 116 EnWG, dass nicht bereits jede vom Gasversorger einseitig vorgenommene Preisänderung zu einer Beendigung der von § 116 Satz 1 EnWG 2005 angeordneten Weitergeltung des alten Rechts (§§ 10 und 11 EnWG 1998 und AVBGasV) sowie der danach auch für Nicht-Haushaltskunden vorgesehenen Grundversorgung führt.
Das Gesetz sieht in § 116 Satz 1 EnWG 2005 für bestehende Tarifkundenverträge mit Nicht-Haushaltskunden im Grundsatz auch für – wie hier – unbefristete Verträge die Fortgeltung des alten Rechts bis zum Vertragsende vor. Wie sich aus den oben genannten Gesetzesmaterialien ergibt, wollte der Gesetzgeber die bestehenden Vertragsverhältnisse mit diesen Kunden, für die § 36 EnWG 2005 eine Grundversorgungspflicht nicht mehr vorsah, unberührt lassen[32] und damit das Fortbestehen dieser Vertragsverhältnisse und der Grundversorgungspflicht über den Zeitpunkt des Inkrafttretens des EnWG 2005 hinaus ermöglichen[33]. Auf diese Weise sollte das Vertrauen der Nicht-Haushaltskunden auf den Fortbestand der Versorgung als Tarifkunden geschützt werden[34].
Eine Ausnahme von diesem Grundsatz der Fortdauer der Grundversorgungspflicht bis zum Ende des Gaslieferungsvertrages ist lediglich für den Fall der Änderung oder des Neuabschlusses des Vertrages vorgesehen (§ 116 Satz 2 EnWG 2005). Bei dem letztgenannten Tatbestandsmerkmal handelt es sich insoweit um eine besondere Form der Beendigung des Tarifkundenvertrages, als der Neuabschluss des Vertrages in der Regel mit einer (vorzeitigen) Beendigung des alten Vertrages einhergeht und ebenso wie diese auf einer Vereinbarung der Parteien beruht. Mit dem Neuabschluss des Vertrages bestätigt der frühere Tarifkunde seinen Willen, aus der allgemeinen Versorgungspflicht entlassen zu werden[35].
Erfordern mithin sowohl die grundsätzliche Regelung in § 116 Satz 1 EnWG als auch die vorbezeichnete Variante des § 116 Satz 2 EnWG eine Willensübereinstimmung der Parteien, um die einschneidende Folge der Beendigung der Grundversorgung eintreten zu lassen, spricht demnach bereits die Gesetzessystematik dafür, die zweite Tatbestandsvariante des § 116 Satz 2 EnWG – die Änderung des Vertrages – nicht an geringere Voraussetzungen zu knüpfen. Erst recht gilt dies angesichts des sich bereits aus dem oben dargestellten Willen des Gesetzgebers ergebenden Regelungsziels des § 116 EnWG, die bisherigen Tarifkundenverträge, die nicht mehr von der Grundversorgungspflicht nach § 36 EnWG 2005 erfasst werden, unberührt zu lassen und damit das Vertrauen der Nicht-Haushaltskunden auf den Fortbestand der Versorgung als Tarifkunden zu schützen. Im Übrigen liefen anderenfalls – was auch die Literatur im Ansatz erkennt[36] – die Übergangsregelungen in § 116 Satz 1 und 2 Alt. 1 EnWG 2005 angesichts der in der Praxis zu verzeichnenden Häufigkeit einseitiger Preisänderungen von Gasversorgern faktisch leer.
Aufgrund des mithin auf das Vertragsverhältnis der Parteien bis zu dessen Beendigung anzuwendenden § 4 Abs. 1 und 2 AVBGasV stand der Gasversorgerin grundsätzlich das Recht zu, die Preise nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) zu ändern. Die Transparenzanforderungen des Art. 3 Abs. 3 Satz 4 bis 6 in Verbindung mit Anhang A der Gas-Richtlinie 2003/55/EG in der durch den Gerichtshof im Urteil vom 23.10.2014[22] vorgenommenen Auslegung stehen dem nicht entgegen.
Allerdings hat der Bundesgerichtshof in seinen Urteilen vom 28.10.2015[37] im Anschluss an das vorbezeichnete Urteil des Gerichtshofs entschieden, dass § 4 Abs. 1 und 2 AVBGasV ein gesetzliches Preisanpassungsrecht des Energieversorgers für die – im vorliegenden Fall maßgebliche – Zeit ab dem 1.07.2004 – dem Ablauf der Umsetzungsfrist der Gas-Richtlinie 2003/55/EG – nicht (mehr) entnommen werden kann, weil eine solche Auslegung nicht mit den vorbezeichneten Transparenzanforderungen vereinbar wäre.
Die in den vorgenannten Urteilen des Bundesgerichtshofs entwickelten Grundsätze sind jedoch auf den Streitfall nicht anzuwenden, da es hier – anders als in den vom Bundesgerichtshof bisher entschiedenen Fällen – nicht um Preisänderungen im Rahmen eines Tarifkundenvertrages mit einem Haushaltskunden gemäß Art. 2 Nr. 25 der Gas-Richtlinie geht, sondern es sich bei dem Gaskunden um einen Nicht-Haushaltskunden gemäß Art. 2 Nr. 26 der genannten Richtlinie handelt. Für diesen Kundenkreis schreibt die Gas-Richtlinie eine Anwendung der Transparenzanforderungen des Art. 3 Abs. 3 Satz 4 bis 6 in Verbindung mit Anhang A nicht zwingend vor, und der nationale Gesetz- und Verordnungsgeber hat diesen Kundenkreis lediglich bis zu einem – hier überschrittenen – Jahresverbrauch von 10.000 Kilowattstunden als Haushaltskunden eingestuft (§ 3 Nr. 22 EnWG 2005).
Gemäß Art. 3 Abs. 3 Satz 6 der Gas-Richtlinie schließen die in deren Art. 3 Abs. 3 Satz 1 bis 5 genannten Maßnahmen zum Schutz des Kunden die in Anhang A aufgeführten Maßnahmen – und damit auch die Transparenzanforderungen gemäß Buchst. b und c dieses Anhangs – „zumindest im Fall der Haushaltskunden“ ein.
Aus der Verwendung des Wortes „zumindest“ folgt – im Sinne eines acte claire[38] – eindeutig, dass die Richtlinie eine Umsetzung der in Anhang A genannten Transparenzanforderungen in nationales Recht zwingend nur für Haushaltskunden vorschreibt, eine Umsetzung auch hinsichtlich der Nicht-Haushaltskunden aber zulässt, sofern die Mitgliedstaaten die Schaffung eines entsprechenden Schutzes dieser Kunden für angezeigt halten. Die Richtlinie strebt mithin insoweit nur eine auf die Haushaltskunden bezogene Mindestharmonisierung an.
Dies wird insbesondere durch den Erwägungsgrund 26 Abs. 2 Satz 2 der Gas-Richtlinie bestätigt, wonach die von den Mitgliedstaaten zum Schutz der Endkunden ergriffenen Maßnahmen für nichtgewerbliche Kunden und kleine und mittlere Unternehmen unterschiedlich ausfallen können.
Nichts anderes ergibt sich daraus, dass die Mitgliedstaaten gemäß Art. 3 Abs. 3 Satz 1 der Gas-Richtlinie geeignete Maßnahmen zum Schutz der Endkunden und zur Gewährleistung eines hohen Verbraucherschutzes zu ergreifen und insbesondere dafür Sorge zu tragen haben, dass für schutzbedürftige Kunden ein angemessener Schutz besteht. Die Gaskundin meint, hieraus lasse sich ableiten, dass die Transparenzanforderungen des Art. 3 Abs. 3 der Gas-Richtlinie insgesamt, mithin auch diejenigen des Anhangs A der Gas-Richtlinie, nicht nur für Haushaltskunden, sondern für sämtliche Endkunden im Sinne des Art. 2 Nr. 27 der Gas-Richtlinie, zu denen auch der Gaskunde gehöre, zu gelten hätten.
Dieser Einwand der Gaskundin greift nicht durch. Zwar trifft es zu, dass der Gaskunde Endkunde im Sinne des Art. 2 Nr. 27 der Gas-Richtlinie ist, da er das Erdgas für den Eigenbedarf gekauft hat. Die Gaskundin lässt jedoch außer Acht, dass der Unionsgesetzgeber die hier in Rede stehenden Transparenzanforderungen des Anhangs A der Gas-Richtlinie, wie sich eindeutig aus dem Inhalt des Art. 3 Abs. 3 Satz 6 dieser Richtlinie und der Systematik der Bestimmungen des vorgenannten Absatzes 3 ergibt, speziell für Haushaltskunden – mithin für diejenige Untergruppe der Endkunden, die das Erdgas für den Eigenverbrauch im Haushalt kauft (Art. 2 Nr. 25 der Gas-Richtlinie; vgl. auch Theobald in Danner/Theobald, aaO, § 3 EnWG Rn.194 aE; Boesche in Säcker, aaO, § 3 EnWG Rn. 132; Salje, aaO, § 3 Rn.190 [jeweils zum Verhältnis der Begriffe des Haushaltskunden und des – dem Endkunden gemäß Art. 2 Nr. 27 der Gas-Richtlinie entsprechenden – Letztverbrauchers im EnWG 2005]) , nicht hingegen für sämtliche Endkunden zwingend beachtet wissen wollte.
Der nationale Gesetzgeber hat – wie oben bereits erwähnt – mit der Legaldefinition in § 3 Nr. 22 EnWG 2005 von der ihm unionsrechtlich eingeräumten Möglichkeit Gebrauch gemacht, den Begriff des Haushaltskunden weiter zu fassen als in Art. 2 Nr. 25 der Gas-Richtlinie 2003/55/EG vorgesehen, indem er als Haushaltskunden auch solche Letztverbraucher ansieht, die Energie für den einen Jahresverbrauch von 10.000 Kilowattstunden nicht übersteigenden Eigenverbrauch für berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke kaufen. Unter diesen erweiterten Haushaltskundenbegriff fällt der Gaskunde aufgrund seines höheren Jahresverbrauchs jedoch nicht.
Auf der Grundlage des vom Landgericht Gießen[4] demgemäß im Ergebnis zu Recht angewendeten § 4 Abs. 1 und 2 AVBGasV kann indes mit der vom Landgericht Gießen[4] gegebenen Begründung weder die Billigkeit der von der Gasversorgerin zum 1.10.2008 und zum 1.01.2010 vorgenommenen Preiserhöhungen, auf die das Landgericht Gießen[4] abgestellt hat, festgestellt noch ein Anspruch der Gasversorgerin auf Zahlung restlichen Entgelts (§ 433 Abs. 2 BGB) in Höhe von 1.521, 70 € nebst Zinsen bejaht werden. Entgegen der Auffassung des Landgerichts Gießen[4] ist die Billigkeit der Preiserhöhungen nicht schon deshalb zu bejahen, weil letztere nach den Feststellungen des Landgerichts Gießen[4] im unteren beziehungsweise mittleren Preisbereich aller bundesweit tätigen Gasanbieter lagen. Auch kann mit der Begründung des Landgerichts Gießen[4] die Billigkeit der vor dem 1.10.2008 vorgenommen Preisänderungen der Gasversorgerin, denen der Gaskunde ebenfalls rechtzeitig widersprochen hat, nicht für unerheblich erachtet werden.
Allerdings können die tatrichterlichen Ausführungen zur Anwendung von § 315 BGB im konkreten Fall vom Revisionsgericht nur darauf überprüft werden, ob das Berufungsgericht den Begriff der Billigkeit verkannt, ob es die gesetzlichen Grenzen seines Ermessens überschritten oder von dem Ermessen in einer dem Zweck der Ermächtigung nicht entsprechenden Weise Gebrauch gemacht hat und ob es von einem rechtlich unzutreffenden Ansatz ausgegangen ist, der ihm den Zugang zu einer fehlerfreien Ermessensentscheidung versperrt hat[39]. Derartige Rechtsfehler sind dem Landgericht Gießen[4] hier unterlaufen.
Das Landgericht Gießen[4] hat zwar die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass die streitgegenständlichen Preiserhöhungen der Billigkeit entsprechen, zutreffend der Gasversorgerin als derjenigen auferlegt, die die Leistungsbestimmung gemäß § 315 Abs. 1 BGB nach billigem Ermessen zu treffen hat[40]. Das Landgericht Gießen[4] ist jedoch, indem es Feststellungen zu den von der Gasversorgerin behaupteten Steigerungen ihrer Bezugskosten nicht getroffen, sondern allein auf den Vergleich des von der Gasversorgerin verlangten Arbeitspreises mit dem Preisniveau anderer Gasanbieter abgestellt hat, von einem rechtlich unzutreffenden Ansatz ausgegangen, der ihm den Zugang zu einer fehlerfreien Ermessensentscheidung versperrt hat.
Nach der auf den vorliegenden Fall noch anwendbaren bisherigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist der Vorschrift des § 4 Abs. 1 und 2 AVBGasV zu entnehmen, dass dem Gasversorgungsunternehmen das Recht zusteht, die Preise nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) zu ändern[41]. Zugleich trifft das Gasversorgungsunternehmen aufgrund der gesetzlichen Bindung des allgemeinen Tarifs an den Maßstab der Billigkeit die Rechtspflicht, bei einer Preisänderung Kostensenkungen ebenso und nach gleichen Maßstäben zu berücksichtigen wie Kostenerhöhungen[42]. Hiervon ist mit Recht auch das Landgericht Gießen[4] ausgegangen.
Im Ausgangspunkt ebenfalls zutreffend hat das Landgericht Gießen[4] angenommen, dass im Rahmen der Prüfung der Wirksamkeit von Preiserhöhungen des Gasgrundversorgers nach § 315 BGB die Billigkeit bei einer bloßen Weitergabe gestiegener (Bezugs)Kosten grundsätzlich zu bejahen ist, soweit die Kostensteigerung nicht durch rückläufige Kosten in anderen Bereichen ausgeglichen wird,[43]. Das Landgericht Gießen[4] hat jedoch rechtsfehlerhaft gemeint, zu den von der Gasversorgerin behaupteten Bezugskostensteigerungen keine Feststellungen treffen zu müssen, weil eine im liberalisierten Gasmarkt vorgenommene Preiserhöhung auch dann der Billigkeit entspreche, wenn der neue Tarif – wie hier nach den Feststellungen des Landgerichts Gießen[4] bei den Preiserhöhungen der Gasversorgerin vom 01.10.2008; und vom 01.01.2010 der Fall – mit den Tarifen konkurrierender Anbieter vergleichbar sei. Diese Auffassung trifft nicht zu.
In der Rechtsprechung der Instanzgerichte und in der Literatur werden zu der vom Landgericht Gießen[4] aufgeworfenen und zum Anlass der Zulassung der Revision genommenen Frage, ob eine Billigkeitskontrolle nach § 315 BGB auf der Grundlage eines Vergleichs mit den Gaspreisen anderer Gasversorgungsunternehmen vorgenommen werden kann, unterschiedliche Auffassungen vertreten.
Nach der einen – vom Landgericht Gießen[4] und von der Gasversorgerin vertretenen – Auffassung ist ein einseitig bestimmter Preis billig im Sinne des § 315 BGB, wenn das verlangte Entgelt im Rahmen des Marktüblichen liegt und dem entspricht, was regelmäßig als Preis für eine vergleichbare Leistung verlangt wird[44]. Dementsprechend wird der neue Tarif eines Gasgrundversorgers im Sinne des § 315 BGB als billig angesehen, wenn er mit den Preisen konkurrierender Anbieter vergleichbar ist, was jedenfalls dann der Fall sein soll, wenn er im Mittelfeld des Preisspektrums liegt[45]. Noch weitergehend will ein Teil der Rechtsprechung der Instanzgerichte bereits die Möglichkeit einer Billigkeitsprüfung nach § 315 Abs. 3 BGB ausschließen, wenn der Kunde die Möglichkeit hatte, Gas von einem anderen Anbieter zu beziehen[46].
Nach anderer – auch von der Gaskundin vertretener – Auffassung ist hingegen bei der Prüfung der Billigkeit nach § 315 BGB auf den konkreten Vertrag abzustellen und der Vertragszweck, die Interessenlage der Parteien sowie die Bedeutung der Leistung umfassend zu würdigen[47], wobei insoweit auch das in vergleichbaren Fällen Übliche zu berücksichtigen sei[48].
Der Bundesgerichtshof hat die Frage, ob eine Billigkeitskontrolle nach § 315 BGB auch auf der Grundlage eines Vergleichs mit den Gaspreisen anderer Gasversorgungsunternehmen vorgenommen werden kann, bisher nicht ausdrücklich entschieden.
Er hat diese Frage sowohl im BGH-Urteil vom 13.06.2007[49] als auch in den BGH-Urteilen vom 19.11.2008[50] und vom 08.07.2009[51] offen lassen können.
Der Bundesgerichtshof hat jedoch in seinem – allerdings die Stromlieferung außerhalb der Grundversorgung von Tarifkunden betreffenden – Urteil vom 02.10.1991[52] ausgeführt, die dortige Gasversorgerin habe ihrer Darlegungslast nicht dadurch genügt, dass sie zur Begründung ihrer Preisbestimmung auf die in der Bundesrepublik Deutschland herrschende Bandbreite der Strompreise und auf diejenigen Entgelte verwiesen habe, die sie von anderen Stromabnehmern fordere. Allerdings könne eine einseitige Preisbestimmung unter Umständen als billig im Sinne von § 315 BGB anzusehen sein, wenn das verlangte Entgelt im Rahmen des Marktüblichen liege und dem entspreche, was regelmäßig als Preis für eine vergleichbare Leistung verlangt werde. Grundsätzlich sei indessen eine umfassende Würdigung des Vertragszwecks sowie der Interessenlage beider Parteien erforderlich, in die weitere Gesichtspunkte einfließen könnten. Für Verträge, die die Lieferung von (elektrischer) Energie zum Gegenstand hätten, müsse der das gesamte Energiewirtschaftsrecht beherrschende Grundsatz berücksichtigt werden, dass die Energieversorgung – unter Beachtung der Anforderungen an die Sicherheit der Versorgung – so preiswürdig wie möglich zu gestalten sei. Abweichend von anderen Wirtschaftszweigen komme hier dem Gesichtspunkt der Gewinnmaximierung nur eingeschränkte Bedeutung zu.
Im Einklang mit dieser Rechtsprechung entscheidet der Bundesgerichtshof die vom Landgericht Gießen[4] aufgeworfene Rechtsfrage für die Gasversorgung nunmehr dahingehend, dass eine Billigkeitskontrolle von einseitig vorgenommenen Preiserhöhungen eines Gasgrundversorgers nach § 315 BGB nicht entscheidend auf der Grundlage eines Vergleichs mit den Gaspreisen anderer Gasversorgungsunternehmen vorgenommen werden kann, sondern es gemäß dem vorgenannten, durch spätere Entscheidungen des Bundesgerichtshofs bestätigten Grundsatz[53] maßgeblich auf den konkreten Gaslieferungsvertrag ankommt und eine umfassende Würdigung des Vertragszwecks sowie der Interessenlage beider Parteien vorzunehmen ist[54]. Im Rahmen dieser Würdigung kann zwar auch der Vergleich mit den Preisen anderer Gasanbieter als ein Indiz von untergeordneter Bedeutung Berücksichtigung finden. Regelmäßig kommt jedoch gemäß der oben erwähnten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zu § 4 Abs. 1, 2 AVBGasV und § 315 BGB dem Umstand zentrale Bedeutung zu, ob die vom Gasversorger einseitig vorgenommene Preiserhöhung auf einer – nicht durch Kostensenkungen in anderen Bereichen ausgeglichen – Steigerung seiner eigenen (Bezugs)Kosten beruht und ob der Gasversorger seiner Verpflichtung nachgekommen ist, bei einer Preisänderung Kostensenkungen ebenso und nach gleichen Maßstäben zu berücksichtigen wie Kostenerhöhungen.
Fehlt es an diesen Voraussetzungen, vermag auch der – hier vom Landgericht Gießen[4] festgestellte – Umstand, dass der vom Gasversorger verlangte erhöhte Preis niedriger ist als derjenige (der Mehrheit) anderer Gasversorger, die Billigkeit der Preiserhöhung nach § 315 BGB nicht zu begründen. Anderenfalls bestünde für den Gasversorger die Möglichkeit, unter einseitiger Veränderung des zwischen ihm und dem Kunden bei Vertragsschluss vereinbarten Äquivalenzverhältnisses allein wegen des höheren Preises anderer Anbieter den eigenen Gewinn zu steigern, ohne dazu auf das Einverständnis des Kunden angewiesen oder zu einer Fortführung des Vertrages mit einer künftig nicht mehr auskömmlichen Gewinnmarge gezwungen zu sein. Hierzu dient das Recht des Gasversorgers, gemäß § 4 Abs. 1 und 2 AVBGasV die Preise nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) zu ändern, jedoch nicht[55].
Soweit das Landgericht Gießen[4] meint, Gegenteiliges aus den – jeweils sogenannte Tagespreisklauseln in Kraftfahrzeugkaufverträgen betreffenden – Urteilen des Bundesgerichtshofs vom 01.02.1984[56] herleiten zu können, da dort der Marktpreis beziehungsweise die Marktpreisentwicklung als das im Rahmen der Billigkeitskontrolle nach § 315 BGB maßgebliche Kriterium anerkannt worden sei, geht dies schon deshalb fehl, weil zum einen ein solcher Grundsatz – der im Übrigen in dieser Allgemeinheit auch nicht mit den oben genannten Maßstäben einer umfassenden Billigkeitskontrolle nach § 315 BGB zu vereinbaren wäre – sich den genannten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs nicht entnehmen lässt und zum anderen die bereits in dem vorbezeichneten Urteil des Bundesgerichtshofs vom 02.10.1991[57] angeführten Besonderheiten des Energiewirtschaftsrechts gelten, welche dagegen sprechen, hier entscheidend auf den Marktpreis beziehungsweise die Marktpreisentwicklung abzustellen.
Die Entscheidung des Landgerichts Gießen[4] erweist sich auch nicht aus anderen Gründen als richtig (§ 561 ZPO). Entgegen der vom Amtsgericht Gießen[58] vertretenen Auffassung, zu der das Landgericht Gießen[4] wegen des von ihm gewählten anderen Begründungsweges – von seinem Rechtsstandpunkt aus folgerichtig – keine Ausführungen gemacht hat, scheidet eine Billigkeitskontrolle nach § 315 BGB nicht etwa deshalb aus, weil für den Gaskunden nach den Feststellungen des Amtsgerichts ab dem Jahre 2007 die Möglichkeit bestand, Erdgas von einem anderen Anbieter zu beziehen.
Der Bundesgerichtshof hat bereits in seinem – nach Erlass der Urteile des Amtsgerichts und des Landgerichts Gießen[4] ergangenen – Urteil vom 09.12 2015[59] ausgeführt, dass gegen die vorgenannte, von einem Teil der Instanzgerichte[60] vertretene Auffassung erhebliche Bedenken bestehen. Dementsprechend entscheidet der Bundesgerichtshof diese Rechtsfrage nunmehr dahingehend, dass in den Fällen, in denen der Gasgrundversorger – wie hier – gemäß § 4 Abs. 1, 2 AVBGasV berechtigt ist, die Preise nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) zu ändern, eine von ihm einseitig vorgenommene Preiserhöhung auch dann der Billigkeitskontrolle nach § 315 BGB unterliegt, wenn für den Tarifkunden die Möglichkeit besteht, das Erdgas von einem anderen Anbieter zu beziehen[61]. Es verstößt auch nicht etwa gegen Treu und Glauben (§ 242 BGB), wenn der Tarifkunde trotz der Möglichkeit eines Wechsels zu einem anderen Gasanbieter das Grundversorgungsverhältnis fortsetzt und in dessen Rahmen eine Billigkeitskontrolle nach § 315 BGB verlangt.
Die gegenteilige Auffassung verkennt, dass der Tarifkunde bei – hier gegebenem – Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen ein Recht auf Grundversorgung hat und es seiner freien Entscheidung obliegt, ob er den bestehenden Gaslieferungsvertrag kündigt (§ 32 AVBGasV) und – im Wege des Abschlusses eines (Norm-)Sonderkundenvertrages – zu einem anderen Gasanbieter wechselt oder nicht. Entscheidet sich der Kunde – wie hier der Gaskunde – für einen Verbleib in der Grundversorgung und steht dem Gasgrundversorger in Fällen wie dem vorliegenden aus § 4 Abs. 1, 2 AVBGasV ein Recht zur Preisänderung zu, unterliegt das hierin zu sehende einseitige Leistungsbestimmungsrecht des Gasversorgers kraft Gesetzes der Billigkeitskontrolle nach § 315 BGB[62]. Auch insoweit ist, wie oben bereits ausgeführt, maßgeblich auf den konkreten Gaslieferungsvertrag abzustellen und folgt aus dem Vorhandensein weiterer Gasanbieter im Gebiet des Kunden nicht, dass die diesem gesetzlich zustehende Billigkeitskontrolle (§ 315 BGB) eingeschränkt oder gar ausgeschlossen wäre.
Dabei steht der im Streitfall gemäß den oben genannten Grundsätzen vorzunehmenden Billigkeitskontrolle nach § 315 BGB auch nicht entgegen, dass diese für den Gasgrundversorger mit einer unangemessenen Belastung insoweit verbunden wäre, als dieser zu einer Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen gezwungen sein könnte, obwohl der Kunde hieran redlicherweise (§ 242 BGB) wegen der bestehenden Möglichkeit des Wechsels zu einem anderen Gasanbieter kein schützenswertes Interesse haben könne[63].
Die Gasversorgerin übersieht hierbei, dass der Bundesgerichtshof bereits in seinen Urteilen vom 19.11.2008[64] und vom 08.07.2009[65] zum Ausdruck gebracht hat, dass grundsätzlich weder für die schlüssige Darlegung noch für die Feststellung einer – hier in Rede stehenden – bloßen Weitergabe von Bezugskostensteigerungen eine Offenlegung der Kalkulation des Gasgrundversorgers erforderlich ist. Diese Auffassung hat der Bundesgerichtshof in den bereits erwähnten Grundsatzurteilen vom 28.10.2015[66] fortentwickelt und insbesondere die Maßstäbe präzisiert, die der Tatrichter bei seiner Überzeugungsbildung hinsichtlich der Weitergabe von (Bezugs)Kostensteigerung anzulegen hat. Diese im Zusammenhang mit der ergänzenden Vertragsauslegung des Tarifkundenvertrages mit Haushaltskunden erfolgten Ausführungen des Bundesgerichtshofs gelten für die im Streitfall vorzunehmende Billigkeitskontrolle (§ 315 BGB) in gleicher Weise[67]. Vor diesem Hintergrund betrachtet erweist sich der Einwand der Gasversorgerin als unbegründet.
Mit der Begründung des Landgerichts Gießen[4] kann auch die Billigkeit der vor dem 1.10.2008 vorgenommenen Preisänderungen der Gasversorgerin, denen der Gaskunde ebenfalls rechtzeitig widersprochen hat, nicht für unerheblich erachtet werden.
Das Landgericht Gießen[4] hat bei seiner gegenteiligen Beurteilung verkannt, dass nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine Preiserhöhung auch deshalb der Billigkeit widersprechen kann, weil die bereits zuvor geltenden Tarife des Gasversorgers – soweit sie über den ursprünglich vereinbarten Preis (Sockelbetrag) hinausgehen – unbillig überhöht waren und der Kunde auch diese Preiserhöhungen in angemessener Zeit gemäß § 315 BGB beanstandet hat[68].
Wie dem Berufungsurteil [4] zu entnehmen ist, hat der Gaskunde bereits der ersten vom Landgericht Gießen[4] festgestellten Preiserhöhung der Gasversorgerin zum 1.10.2004 durch Schreiben vom 18.11.2004 widersprochen und sich auch gegen die späteren Preiserhöhungen der Gasversorgerin durch mehrere Widerspruchsschreiben gewandt. Diesen Umstand wird das Landgericht Gießen[4] im Rahmen der neu vorzunehmenden Prüfung der Billigkeit nach § 315 BGB zu berücksichtigen haben.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 24. Februar 2016 – VIII ZR 216/12
- Fortführung von BGH, Urteile vom 28.10.2015 – VIII ZR 158/11, ZIP 2015, 2226, zur Veröffentlichung in BGHZ bestimmt, und – VIII ZR 13/12; vom 09.12 2015 – VIII ZR 208/12 – VIII ZR 236/12 und – VIII ZR 330/12[↩]
- EuGH, Urteil vom 23.10.2014 – C-359/11 und C-400/11, NJW 2015, 849 – Schulz und Egbringhoff[↩]
- Fortführung von BGH, Urteile vom 02.10.1991 – VIII ZR 240/90, WM 1991, 2065 unter – III 1 und 2 a mwN; vom 18.10.2007 – III ZR 277/06, BGHZ 174, 48 Rn.20; vom 18.10.2011 – KZR 18/10, WM 2012, 622 Rn. 17[↩]
- LG Gießen, Urteil vom 06.05.2012 – 1 S 20/12[↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩][↩]
- siehe zuletzt BGH, Urteile vom 02.07.2014 – VIII ZR 316/13, BGHZ 202, 17 Rn. 10; vom 22.07.2014 – VIII ZR 313/13, BGHZ 202, 158 Rn. 12; jeweils mwN[↩]
- BGH, Urteil vom 28.03.2007 – VIII ZR 144/06, BGHZ 171, 374 Rn.20[↩]
- BGH, Urteil vom 06.07.2011 – VIII ZR 217/10, NJW 2011, 3509 Rn. 16[↩]
- aA vgl. LG Bochum, RdE 1987, 246; AG Ludwigshafen, RdE 1989, 82 [jeweils zum Stromlieferungsvertrag][↩]
- in der im BGBl. III, Gliederungsnummer 7521, veröffentlichten bereinigten Fassung[↩]
- BGBl. I S. 730[↩]
- BGBl. I S.1970[↩]
- st. Rspr.; siehe nur BGH, Urteile vom 28.10.2015 – VIII ZR 158/11, ZIP 2015, 2226 Rn. 17, zur Veröffentlichung in BGHZ bestimmt, und – VIII ZR 13/1220; jeweils mwN[↩]
- BGH, Urteile vom 28.10.2015 – VIII ZR 158/11, aaO Rn. 18, und – VIII ZR 13/12, aaO Rn. 21; jeweils mwN[↩]
- BGBl. I S. 676 – AVBGasV[↩]
- BGBl. I S. 2391[↩]
- Säcker in Säcker, Berliner Kommentar zum Energierecht, 3. Aufl., § 116 EnWG Rn. 2; de Wyl in Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, 4. Aufl., § 14 Rn.19; Groß, NJW 2007, 1030, 1033; Danzeisen, RdE 2007, 288, 289; Eder in Danner/Theobald, Energierecht, Stand Juni 2015, § 36 EnWG Rn. 17; vgl. auch BT-Drs. 15/3917, S. 66; Salje, Energiewirtschaftsgesetz, 2006, § 116 Rn. 3[↩]
- st. Rspr.; siehe nur BGH, Urteile vom 24.06.1988 – V ZR 49/87, NJW 1988, 2878 unter 2 b; vom 07.02.2002 – I ZR 304/99, BGHZ 150, 32, 39; vom 22.06.2005 – VIII ZR 214/04, NJW-RR 2005, 1323 unter – II 2 a; vom 06.07.2005 – VIII ZR 136/04, NJW 2005, 3205 unter – II 2 a bb; vom 11.10.2012 – IX ZR 30/10, WM 2012, 2144 Rn. 14; vom 27.03.2013 – I ZR 9/12, WRP 2013, 1619 Rn. 46; jeweils mwN[↩]
- vgl. BGH, Urteile vom 02.07.2014 – VIII ZR 316/13, aaO; vom 22.07.2014 – VIII ZR 313/13, aaO; jeweils mwN[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 09.07.2014 – VIII ZR 376/13, BGHZ 202, 39 Rn. 38[↩]
- vgl. hierzu bereits RGZ 141, 99, 103, sowie BGH, Urteil vom 05.10.1951 – I ZR 92/50, BGHZ 3, 200, 202, und OLG München, Urteil vom 14.02.1972 – 21 U 2941/71 48[↩]
- vgl. hierzu BGH, Urteil vom 28.10.2015 – VIII ZR 158/11, aaO Rn.19 mwN[↩]
- EuGH, Urteil vom 23.10.2014 – C-359/11 und C-400/11, aaO – Schulz und Egbringhoff[↩][↩]
- BGH, Urteile vom 28.10.2015 – VIII ZR 158/11, aaO; und – VIII ZR 13/12, aaO[↩]
- vgl. BGH, Urteile vom 28.10.2015 – VIII ZR 158/11, aaO Rn. 68, und – VIII ZR 13/12, aaO Rn. 70[↩]
- vgl. Salje, aaO, § 115 Rn. 2 und § 116 Rn. 4[↩]
- Säcker, aaO Rn. 2 f.; Salje, aaO, § 116 Rn. 3 f.; Danzeisen, aaO[↩]
- Säcker, aaO Rn. 3; Salje, aaO Rn. 8[↩]
- Hellermann in Britz/Hellermann/Hermes, Energiewirtschaftsgesetz, 3. Aufl., § 3 Rn. 41; Hempel in Hempel/Franke, Recht der Energie- und Wasserversorgung, Stand September 2014, § 36 EnWG Rn. 68; Salje, aaO, § 3 Rn. 175[↩]
- Hempel, aaO Rn. 72[↩]
- Salje, aaO, § 116 Rn. 15; de Wyl in Schneider/Theobald, aaO; de Wyl/Eder/Hartmann, Netzanschluss- und Grundversorgungsverordnungen, 2008, § 23 StromGVV/GasGVV Rn. 6; Hartmann in Danner/Theobald, aaO, § 23 StromGVV Rn. 16; Groß, aaO S. 1034; Danzeisen, aaO; Scholz in Bartsch/Röhling/Salje/Scholz, Stromwirtschaft, 2. Aufl., Kapitel 60 Rn. 38[↩]
- BT-Drs. 15/3917, S. 76[↩]
- BT-Drs., aaO[↩]
- vgl. Säcker, aaO Rn. 3[↩]
- Salje, aaO Rn. 8 f.[↩]
- Salje, aaO Rn. 16[↩]
- vgl. Groß, aaO; Danzeisen, aaO; Scholz, aaO[↩]
- BGH, Urteil vom 28.10.2015 – VIII ZR 158/11, aaO Rn. 33 ff., und – VIII ZR 13/12, aaO Rn. 35 ff.; bestätigt durch BGH, Urteile vom 09.12 2015 – VIII ZR 208/12; – VIII ZR 236/12; und – VIII ZR 330/12[↩]
- vgl. EuGH, Urteil vom 09.09.2015 – C72/14; BVerfG, GmbHR 2013, 598, 600; BGH, Urteil vom 16.09.2015 – VIII ZR 17/15, WM 2015, 2058 Rn. 33; jeweils mwN[↩]
- BGH, Urteile vom 18.10.2007 – III ZR 277/06, BGHZ 174, 48 Rn. 21; vom 19.11.2008 – VIII ZR 138/07, BGHZ 178, 362 Rn. 28; vom 08.07.2015 – VIII ZR 106/14, NJW 2015, 3564 Rn. 26; jeweils mwN[↩]
- BGH, Urteil vom 19.11.2008 – VIII ZR 138/07, aaO mwN[↩]
- siehe nur BGH, Urteile vom 13.06.2007 – VIII ZR 36/06, BGHZ 172, 315 Rn. 14 ff.; vom 19.11.2008 – VIII ZR 138/07, aaO Rn. 26; vom 15.07.2009 – VIII ZR 56/08, BGHZ 182, 41 Rn. 18 ff.; ebenso BGH, Urteil vom 29.04.2008 – KZR 2/07, BGHZ 176, 244 Rn. 26[↩]
- BGH, Urteile vom 15.07.2009 – VIII ZR 225/07, BGHZ 182, 59 Rn. 28; vom 13.01.2010 – VIII ZR 81/08, WM 2010, 481 Rn. 18; jeweils mwN; ebenso BGH, Urteil vom 29.04.2008 – KZR 2/07, aaO[↩]
- vgl. BGH, Urteile vom 19.11.2008 – VIII ZR 138/07, aaO Rn. 30, 39; vom 08.07.2009 – VIII ZR 314/07, NJW 2009, 2894 Rn.20, 33; vom 15.07.2009 – VIII ZR 225/07, aaO Rn. 26; jeweils mwN[↩]
- MünchKomm-BGB/Würdinger, 7. Aufl., § 315 Rn. 29 mwN[↩]
- LG Stendal, Urteil vom 10.03.2011 – 22 S 71/10 30 mwN[↩]
- LG Kiel, ZNER 2004, 401 Rn. 21; LG Magdeburg, RdE 2005, 22, 23; LG Mühlhausen, RdE 2008, 215, 216; LG Köln, Urteil vom 04.02.2009 – 90 O 35/08 8; LG Münster, Urteil vom 13.07.2010, ZNER 2010, 609; vgl. auch LG München II, RdE 2007, 323, 324; LG Frankenthal RdE 2010, 73[↩]
- vgl. OLG Frankfurt am Main, Urteil vom 08.09.2015 – 11 U 124/12 70; wohl auch OLG Stuttgart, ZNER 2011, 69, 72; vgl. auch OLG Karlsruhe, RdE 2006, 356, 358[↩]
- Palandt/Grüneberg, BGB, 75. Aufl., § 315 Rn. 10; Erman/Hager, BGB, 14. Aufl., § 315 Rn.19; Jauernig/Stadler, BGB, 16. Aufl., § 315 Rn. 7; Hk-BGB/Schulze, 8. Aufl., § 315 Rn. 6; BeckOGK-BGB/Netzer, Stand November 2015, § 315 Rn. 75 f.; vgl. BeckOK-BGB/Gehrlein, Stand November 2015, § 315 Rn. 5[↩]
- BGH, Urteil vom 13.06.2007 – VIII ZR 36/06, aaO Rn. 21[↩]
- BGH, Urteil vom 19.11.2008 – VIII ZR 138/07, aaO Rn. 48[↩]
- BGH, Urteil vom 08.07.2009 – VIII ZR 314/07, aaO Rn. 24[↩]
- BGH, Urteil vom 02.10.1991 – VIII ZR 240/90, WM 1991, 2065 unter – III 1 und 2 a mwN[↩]
- vgl. nur BGH, Urteile vom 18.10.2007 – III ZR 277/06, aaO Rn.20; vom 18.10.2011 – KZR 18/10, WM 2012, 622 Rn. 17; ebenso BAGE 112, 80, 83 f.; 147, 322, 334; vgl. auch BGH, Urteil vom 28.04.2009 – XI ZR 86/08, WM 2009, 1180 Rn. 34; jeweils mwN[↩]
- in diesem Sinne bereits BGH, Beschluss vom 06.07.1955 – GSZ 1/55, BGHZ 18, 149, 152; BGH, Urteil vom 02.04.1964 – KZR 10/62, BGHZ 41, 271, 279 mwN[↩]
- st. Rspr.: BGH, Urteile vom 13.06.2007 – VIII ZR 36/06, aaO Rn. 22; vom 19.11.2008 – VIII ZR 138/07, aaO Rn. 25, 30[↩]
- BGH, Urteile vom 01.02.1984 – VIII ZR 54/83, BGHZ 90, 69, 78 f.; und – VIII ZR 106/83 34[↩]
- BGH, Urteil vom 02.10.1991 – VIII ZR 240/90, aaO[↩]
- AG Gießen, Urteil vom 23.12.2011 – 45 C 192/11[↩]
- BGH, Urteil vom 09.12.2015 – VIII ZR 330/12 38[↩]
- vgl. hierzu die oben genannten Entscheidungen[↩]
- ebenso OLG Frankfurt am Main, aaO Rn. 67[↩]
- vgl. OLG Frankfurt am Main, aaO[↩]
- vgl. hierzu auch OLG Frankfurt am Main, aaO Rn. 72 f.[↩]
- BGH, Urteil vom 19.11.2008 – VIII ZR 138/07, aaO Rn. 45 ff.[↩]
- BGH, Urteil vom 08.07.2009 – VIII ZR 314/07, aaO Rn. 21, 30 f.[↩]
- BGH, Urteile vom 28.10.2015 – VIII ZR 158/11, aaO Rn. 89 ff.; und – VIII ZR 13/12, aaO Rn. 91 ff.[↩]
- vgl. BGH, Urteile vom 28.10.2015 – VIII ZR 158/11, aaO Rn. 89, und – VIII ZR 13/12, aaO Rn. 91[↩]
- vgl. BGH, Urteil vom 14.07.2010 – VIII ZR 6/08 17 mwN[↩]