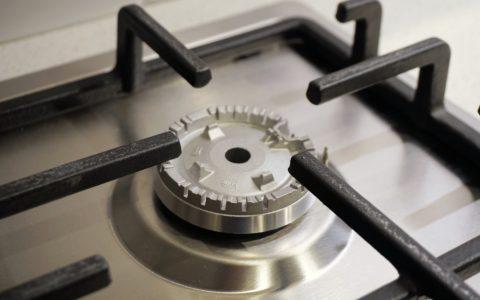In einer überdurchschnittlichen Anzahl von Messstellen pro Ausspeisepunkt liegt eine Besonderheit der Versorgungsaufgabe im Sinne des § 15 Abs. 1 Satz 1 ARegV.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gehören zur Versorgungsaufgabe im Sinne von § 15 Abs. 1 Satz 1 ARegV in der hier maßgeblichen, bis 21.08.2013 geltenden Fassung – die seit 22.08.geltende neue Fassung[1] findet erst ab der zweiten Regulierungsperiode Anwendung[2] – alle Anforderungen, die an den Netzbetreiber von außen herangetragen werden und denen er sich nicht oder nur mit unzumutbarem Aufwand entziehen kann. Dies sind, wie der Bundesgerichtshof bereits wiederholt entschieden hat, nicht nur die in § 10 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 3 ARegV ausdrücklich aufgeführten Parameter, also die Fläche des versorgten Gebiets, die Anzahl der Anschlusspunkte und die Jahreshöchstlast, sondern auch alle anderen Rahmenbedingungen, mit denen sich der Netzbetreiber beim Betrieb des Netzes konfrontiert sieht und auf die er keinen unmittelbaren Einfluss hat[3].
Der Bundesgerichtshof hat bereits entschieden, dass eine über dem Durchschnitt der Netzbetreiber von Elektrizitätsverteilernetzen liegende Anzahl von Zählpunkten eine nach § 15 Abs. 1 Satz 1 ARegV relevante Besonderheit darstellen kann. Dies hat er damit begründet, dass die Anzahl von Zählpunkten ähnlich wie die in § 10 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 ARegV ausdrücklich genannte Anzahl der Anschlusspunkte in der Regel durch Kundenanforderungen vorgegeben; und vom Netzbetreiber allenfalls in begrenztem Umfang beeinflussbar ist[4].
Für die Anzahl der Messstellen eines Gasverteilernetzes gilt dies gleichermaßen[5]. Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde führt der Umstand, dass die Anzahl der Messstellen und deren Verhältnis zur Anzahl der Ausspeisepunkte bei der Entwicklung des Modells für den Effizienzvergleich als nicht signifikant eingestuft worden ist, nicht zu einer abweichenden Beurteilung.
Die Bereinigung des Effizienzwerts gemäß § 15 Abs. 1 ARegV dient gerade dazu, Umständen Rechnung zu tragen, die in die Berechnung des Effizienzwerts nicht eingeflossen sind. Nach § 15 Abs. 1 Satz 1 ARegV setzt eine Bereinigung unter anderem voraus, dass die Besonderheiten im Effizienzvergleich durch die Auswahl der Parameter nach § 13 Abs. 3 und 4 ARegV nicht hinreichend berücksichtigt wurden. Angesichts dessen darf eine Bereinigung des Effizienzwerts nicht deshalb abgelehnt werden, weil dem in Rede stehenden Umstand bei der dem Effizienzvergleich zugrundeliegenden generalisierenden Betrachtung keine signifikante Bedeutung zukommt[6].
Anders als die Rechtsbeschwerde meint, ergibt sich aus dem in § 15 Abs. 1 Satz 1 ARegV normierten Tatbestandsmerkmal einer nicht hinreichenden Berücksichtigung der Besonderheit im Effizienzvergleich nichts anderes. Die Bedeutung dieses Kriteriums erschöpft sich nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs darin, dass es sich bei der von dem Netzbetreiber geltend gemachten Besonderheit der Versorgungsaufgabe um eine solche – untypische – Besonderheit handeln muss, die in den für den Effizienzvergleich herangezogenen Vergleichsparametern nicht berücksichtigt wird[7]. Dies ist im Hinblick auf die Anzahl der Messstellen und deren Verhältnis zur Anzahl der Ausspeisepunkte – was auch die Bundesnetzagentur nicht in Abrede stellt – der Fall.
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs können Mehrkosten nur insoweit berücksichtigt werden, als sie durch die in Rede stehende Besonderheit der Versorgungsaufgabe verursacht werden. Besteht die Besonderheit darin, dass eine mit hohen Kosten verbundene Leistung überdurchschnittlich häufig erbracht werden muss, genügt es deshalb nicht, die Mehrkosten allein anhand der Zahl der Leistungseinheiten und der für eine Leistungseinheit durchschnittlich anfallenden Kosten zu berechnen. Vielmehr ist darzulegen und erforderlichenfalls unter Beweis zu stellen, in welchem Umfang die Kosten für diese Leistung – hier die Einrichtung und der Betrieb von Messstellen – gerade dadurch angestiegen sind, dass ihr Anteil an den insgesamt erbrachten Leistungen größer ist, als dies dem Durchschnitt entspricht[8]. Erforderlich ist ein Nachweis der Mehrkosten, die gerade dadurch entstehen, dass die Anzahl der Messstellen pro Ausspeisepunkt über dem Durchschnitt liegt. Maßgeblich ist insoweit die Kostensituation des betroffenen Netzbetreibers[9].
Im hier vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall genügte das Vorbringen der Gasnetzbetreiberin zum Nachweis der in § 15 Abs. 1 Satz 1 ARegV normierten Voraussetzungen allerdings nicht den in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs entwickelten Anforderungen:
Die Gasnetzbetreiberin hat vorliegend nach den Feststellungen des Beschwerdegerichts die Mehrkosten auf Basis des variablen Kostenanteils berechnet, indem sie in einem ersten Schritt die tatsächliche Höhe der variablen Kostenanteile pro Zählpunkt ermittelt und sodann in einem zweiten Schritt daraus durch schlichte Multiplikation die Differenz zwischen den Kosten für 2, 87 Zählpunkte pro Ausspeisepunkt und 1, 2 Zählpunkten pro Ausspeisepunkt gebildet hat; diese Differenz (Mehrkosten pro Ausspeisepunkt) hat sie schließlich mit der Anzahl der Ausspeisepunkte multipliziert. Diese auf einer pauschalen Grundlage beruhende und diesen Ansatz nicht verlassende – Berechnung eines anhand der variablen Kosten ermittelten Durchschnittswerts genügt zum Nachweis der in § 15 Abs. 1 Satz 1 ARegV normierten Voraussetzungen nicht. Die Betroffene hätte vielmehr darlegen und unter Beweis stellen müssen, in welchem Umfang die Kosten für die Messstellen gerade dadurch angestiegen sind, dass pro Ausspeisepunkt mehr Messstellen vorhanden sind, als dies dem Durchschnitt entspricht. Der Ansatz der genehmigten Preise ist dafür selbst dann ungeeignet, wenn diese die durchschnittlichen Kosten einer Messstelle widerspiegeln. Aus dieser Berechnungsweise ergibt sich nämlich nicht, ob die Kosten einer Messstelle an einem Ausspeisepunkt, dem weitere Messstellen zugeordnet sind, diesen durchschnittlichen Kosten entsprechen oder ob sie – zum Beispiel im Hinblick auf die mit der Zuordnung zu einem gemeinsamen Ausspeisepunkt zu erwartende räumliche Nähe der Messstellen oder wegen anderer Besonderheiten – deutlich geringer sind. Erforderlich wäre ein Nachweis der Mehrkosten, die gerade dadurch entstehen, dass die Anzahl von Messstellen pro Ausspeisepunkt über dem Durchschnitt liegt[10]. Dies hätte etwa dadurch geschehen können, dass die Kosten für Messstellen an Ausspeisepunkten, denen keine weiteren Messstellen zugeordnet sind, den Kosten für Messstellen an den sonstigen Ausspeisepunkten gegenübergestellt werden.
Daraus ergeben sich – auch im Hinblick auf die Anzahl von über 200.000 Messstellen – keine unzumutbaren Anforderungen an die Darlegungslast des Netzbetreibers. Der Nachweis einer relevanten Kostensteigerung obliegt nach § 15 Abs. 1 Satz 1 ARegV dem Netzbetreiber. Er trägt deshalb das Risiko der Nichterweislichkeit[11]. Der Aufwand, der mit dem Nachweis der Mehrkosten verbunden ist, kann im Grundsatz nicht zu einer Herabsetzung der Anforderungen an diesen Nachweis führen.
Dagegen ist nicht zu beanstanden, wenn für die anteilige Berechnung der Kapitalkosten des Messstellenbetriebs auf die Wiederbeschaffungswerte aller Messgeräte abgestellt wird. Insoweit ist zwar zutreffend, dass nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs die Berechnung der Mehrkosten im Hinblick auf die kalkulatorischen Abschreibungen der Altanlagen nach den Maßgaben des § 6 Abs. 2 GasNEV auf Basis der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten zu erfolgen hat[12]. Dies gilt indes nur für die Berechnung der Mehrkosten als solche. Steht wie hier nur der Anteil der Kapitalkosten des Messstellenbetriebs an den gesamten Kapitalkosten in Rede, ist es aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, wenn dieser Anteil auf einem anderen Weg ermittelt wird. Dass dies hier nicht sachgerecht gewesen ist und zu einem unrichtigen Ergebnis geführt hat, hat die Rechtsbeschwerde nicht dargelegt.
Bundesgerichtshof, Beschluss vom 16. Dezember 2014 – EnVR 54/13
- BGBl. I 2013, S. 3250[↩]
- BR-Drs. 447/13 (Beschluss), S. 31[↩]
- BGH, Beschlüsse vom 09.10.2012 – EnVR 88/10, RdE 2013, 22 Rn. 59 – SWM Infrastruktur GmbH; vom 21.01.2014 – EnVR 12/12, RdE 2014, 276 Rn. 112 – Stadtwerke Konstanz GmbH; und vom 07.10.2014 – EnVR 25/12 Rn. 44[↩]
- BGH, Beschluss vom 09.10.2012 – EnVR 88/10, RdE 2013, 22 Rn. 70 ff. – SWM Infrastruktur GmbH[↩]
- BGH, Beschluss vom 21.01.2014 – EnVR 12/12, RdE 2014, 276 Rn. 114 Stadtwerke Konstanz GmbH[↩]
- BGH, Beschluss vom 07.10.2014 – EnVR 25/12 51[↩]
- BGH, Beschluss vom 09.10.2012 – EnVR 88/10, RdE 2013, 22 Rn. 62 – SWM Infrastruktur GmbH[↩]
- BGH, Beschlüsse vom 09.10.2012 – EnVR 88/10, RdE 2013, 22 Rn. 76 f. – SWM Infrastruktur GmbH; und vom 07.10.2014 – EnVR 25/12 Rn. 57[↩]
- BGH, Beschluss vom 09.10.2012 – EnVR 86/10, ZNER 2012, 609 Rn. 30[↩]
- vgl. BGH, Beschlüsse vom 09.10.2012 – EnVR 88/10, RdE 2013, 22 Rn. 77 – SWM Infrastruktur GmbH und EnVR 86/10, ZNER 2012, 609 Rn. 25[↩]
- vgl. BGH, Beschluss vom 09.10.2012 – EnVR 86/10, ZNER 2012, 609 Rn. 31[↩]
- vgl. BGH, Beschluss vom 07.10.2014 – EnVR 25/12, Rn. 61[↩]