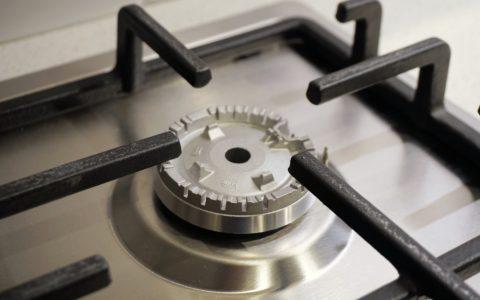Der Bundesgerichtshofs hatte sich aktuell mit der Frage zu befassen, ob eine in einem Gaslieferungsvertrag enthaltene formularmäßige Preisanpassungsklausel (Spannungsklausel), nach der sich der Arbeitspreis für die Lieferung von Gas zu bestimmten Zeitpunkten ausschließlich in Abhängigkeit von der Preisentwicklung für Heizöl ändert, bei ihrer Verwendung gegenüber einer Wohnungseigentümergemeinschaft der Inhaltskontrolle nach § 307 Abs. 1 BGB standhält.

Ähnliche formularmäßig vereinbarte Preisanpassungsklauseln wie die hier verwendete hatte der Bundesgerichtshof bereits in früheren Urteilen bei einer Verwendung gegenüber Unternehmern als wirksam erachtet[1], bei einer Verwendung gegenüber Verbrauchern jedoch entschieden, dass sie der Inhaltskontrolle nicht standhalten, soweit sie künftige Preisänderungen betreffen[2].
In den drei heute verhandelten Verfahren haben die Wohnungseigentümergemeinschaften geltend gemacht, dass sie als Verbraucher anzusehen seien. Deswegen sei die Preisanpassungsklausel unwirksam, so dass sie die vom Versorgungsunternehmen verlangten erhöhten Beträge nicht schuldeten beziehungsweise ihnen ein Rückforderungsanspruch zustehe, soweit sie die verlangten Beträge gezahlt hätten.
Im ersten Verfahren[3] geht es dabei um einen Betrag von 184.736, 56 € für einen Lieferzeitraum von 2 ½ Jahren. Das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg hatte in allen Verfahren ein wirksames Preisanpassungsrecht bejaht und deshalb zugunsten des Versorgungsunternehmens entschieden[4].
Der Bundesgerichtshof hat die in Literatur und Rechtsprechung umstrittene Frage, ob die Wohnungseigentümergemeinschaft als Verbraucher gemäß § 13 BGB anzusehen ist, nunmehr bejaht. Die Wohnungseigentümergemeinschaft ist im Interesse des Verbraucherschutzes der in ihr zusammengeschlossenen, nicht gewerblich handelnden natürlichen Personen regelmäßig einem Verbraucher gleichzustellen, nämlich immer dann, wenn ihr wenigstens ein Verbraucher angehört und sie ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder einer gewerblichen noch einer selbständigen beruflichen Tätigkeit dient.
Als entscheidend hat der Bundesgerichtshof angesehen, dass eine natürliche Person ihre Schutzwürdigkeit als Verbraucher nicht dadurch verliert, dass sie – durch den Erwerb von Wohnungseigentum kraft Gesetzes (zwingend) – Mitglied einer Wohnungseigentümergemeinschaft wird. Hinzu kommt, dass die Wohnungseigentümergemeinschaft beim Abschluss von Rechtsgeschäften mit Dritten in der Regel – und damit auch bei Energielieferungsverträgen, die – wie hier – der Deckung des eigenen Bedarfs dienen – zum Zwecke der privaten Vermögensverwaltung ihrer Mitglieder und damit nicht zu gewerblichen Zwecken handelt. Dies gilt auch dann, wenn die Wohnungseigentümergemeinschaft bei Vertragsschluss durch eine gewerbliche Hausverwaltung vertreten wird. Denn für die Abgrenzung von unternehmerischem und privatem Handeln im Sinne der §§ 13, 14 BGB kommt es im Falle einer Stellvertretung grundsätzlich auf die Person des Vertretenen an.
Unter Anwendung dieser Grundsätze ist in den hier vom Bundesgerichtshofs entschiedenen Verfahren nach den vom Hanseatischen Oberlandesgericht Hamburg bereits getroffenen Feststellungen[5] bzw. nach dem revisionsrechtlich vom Bundesgerichtshof zugrunde zu legenden Sachverhalt[6] von einer Verbrauchereigenschaft der Wohnungseigentümergemeinschaften und damit von einer Unwirksamkeit der den streitgegenständlichen Preiserhöhungen zugrunde liegenden Vertragsbestimmungen auszugehen.
Der Bundesgerichtshof hat die drei Berufungsurteile des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg[7] deshalb aufgehoben und die Verfahren an das Oberlandesgericht in Hamburg zurückverwiesen, damit die erforderlichen Feststellungen zu dem jeweils geschuldeten Arbeitspreis – sowie in einem der Verfahren[3] zur personellen Zusammensetzung der Wohnungseigentümergemeinschaft – nachgeholt werden können.
Bundesgerichtshof, Urteile vom 24. März 2015 – VIII ZR 243/13 – VIII ZR 360/13 und VIII ZR 109/14
- BGH, Urteile vom 14.05.2014 – – VIII ZR 114/13, BGHZ 201, 230, und – VIII ZR 116/13, VersorgW 2014, 212[↩]
- BGH, Urteile vom 24.03.2010 – VIII ZR 178/08, BGHZ 185, 96, und – VIII ZR 304/08, WM 2010, 1050[↩]
- BGH – VIII ZR 243/13[↩][↩]
- OLG Hamburg, Urteil vom 17.07.2013 – 4 U 38/13[↩]
- BGH – VIII ZR 360/12 und – VIII ZR 109/14; vgl. OLG Hamburg, Urteile vom 12.11.2013 – 7 U 59/10; und vom 06.03.2014 5 U 108/11[↩]
- BGH – VII 243/13[↩]
- OLG Hamburg, Urteile vom 17.07.2013 – 4 U 38/13; vom 12.11.2013 – 7 U 59/10; und vom 06.03.2014 – 5 U 108/11[↩]