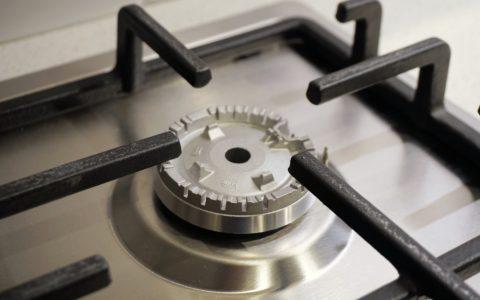Dem Gericht steht bei der Beurteilung, ob die Preiserhöhungen des Energieversorgers dessen (Bezugs)Kostensteigerungen (hinreichend) abbilden, ein Ermessen zu.

Der Bundesgerichtshof hat in seiner früheren ständigen Rechtsprechung aus § 4 Abs. 1, 2 AVBGasV beziehungsweise aus § 5 Abs. 2 GasGVV[1] (im Folgenden GasGVV aF) ein nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) bestehendes Preisänderungsrecht des Gasgrundversorgers entnommen[2]. Wie der Bundesgerichtshof im Anschluss an das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 23.10.2014[3] entschieden hat, kann aus § 4 Abs. 1 und 2 AVBGasV beziehungsweise aus § 5 Abs. 2 GasGVV aF für die Zeit ab 1.07.2004 – dem Ablauf der Umsetzungsfrist der Gasrichtlinie 2003/55/EG – ein einseitiges Preisänderungsrecht des Versorgers nicht entnommen werden, weil eine solche Annahme nicht mit den Transparenzanforderungen des Art. 3 Abs. 3 Sätze 4 bis 6 in Verbindung mit Anhang A der vorgenannten Gas-Richtlinie (aufgehoben zum 3.03.2011 durch Art. 53 der Gas-Richtlinie 2009/73/EG) zu vereinbaren ist[4].
Wie der Bundesgerichtshof in den Urteilen vom 28.10.2015[5] weiter entschieden hat, ergibt sich jedoch aus der gebotenen und an dem objektiv zu ermittelnden hypothetischen Willen der Vertragsparteien auszurichtenden ergänzenden Auslegung (§§ 157, 133 BGB) eines – wie hier – auf unbestimmte Dauer angelegten Gaslieferungsvertrags, dass der Grundversorger berechtigt ist, Steigerungen seiner (Bezugs)Kosten, soweit diese nicht durch Kostensenkungen in anderen Bereichen ausgeglichen werden, während der Vertragslaufzeit an seine Kunden weiterzugeben, und er verpflichtet ist, bei einer Tarifanpassung Kostensenkungen ebenso zu berücksichtigen wie Kostenerhöhungen.
Die Beurteilung der Wirksamkeit einer einseitigen Preisbestimmung des Grundversorgers während der Vertragslaufzeit konzentriert sich mithin auf die tatsächliche Frage, ob die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt sind.
Der Bundesgerichtshof hat in den Urteilen vom 28.10.2015[6] entschieden, dass dem Tatrichter bei der Beurteilung, ob die Preiserhöhungen des Energieversorgers dessen (Bezugs)Kostensteigerungen (hinreichend) abbilden, ein Ermessen zusteht. (Bezugs)Kostensteigerungen (hinreichend) abbilden, ein Ermessen zusteht. Dessen Ausübung unterliegt nur einer eingeschränkten revisionsgerichtlichen Überprüfung darauf, ob sie auf grundsätzlich falschen oder offenbar unrichtigen Erwägungen beruht, erhebliches Vorbringen der Parteien unberücksichtigt gelassen, Rechtsgrundsätze der Bemessung verkannt, wesentliche Bemessungsfaktoren außer Betracht gelassen oder bei einer etwaigen Schätzung unrichtige Maßstäbe zu Grunde gelegt wurden.
So hat der Bundesgerichtshof die auch im Rahmen der ergänzenden Vertragsauslegung zu berücksichtigende tatrichterliche Erwägung gebilligt, dass dem Energieversorgungsunternehmen bei der Weitergabe von (Bezugs)Kostensteigerungen – auch mit Rücksicht auf die oftmals nicht sicher voraussehbare Entwicklung der Bezugskosten – ein Ermessensspielraum zuzugestehen ist. Denn bei einem Massengeschäft wie dem Tarifkundenvertrag liegt es – auch aus Praktikabilitätsgründen – im Interesse beider Vertragsparteien, eine Weitergabe von Kostensenkungen und Kostenerhöhungen nicht – was regelmäßig mit einem die Energieversorgung unnötigerweise verteuernden hohen Aufwand verbunden wäre – tagesgenau vorzunehmen, sondern auf die Kostenentwicklung in einem gewissen Zeitraum abzustellen. Wie lange der Zeitraum für die vorbezeichnete Gesamtbetrachtung sein muss, lässt sich, wenn auch das Gaswirtschaftsjahr ein in den meisten Fällen geeigneter Prüfungsmaßstab sein wird, nicht generell bestimmen, sondern bedarf der Beurteilung des Tatrichters auf der Grundlage der Umstände des Einzelfalls[7].
Bundesgerichtshof, Beschluss vom 15. Dezember 2015 – VIII ZR 76/13
- in der bis zum 29.10.2014 geltenden Fassung vom 26.10.2006, BGBl. I S. 2391[↩]
- vgl. nur BGH, Urteile vom 13.06.2007 – VIII ZR 36/06, BGHZ 172, 315 Rn. 14 ff.; vom 19.11.2008 – VIII ZR 138/07, BGHZ 178, 362 Rn. 26; ebenso BGH, Urteil vom 29.04.2008 – KZR 2/07, BGHZ 176, 244 Rn. 26, 29[↩]
- EuGH, Urteil vom 23.10.2014 – C359/11 und C400/11, NJW 2015, 849 – Schulz und Egbringhoff[↩]
- BGH, Urteile vom 28.10.2015 – VIII ZR 158/11, aaO Rn. 33 ff.; und – VIII ZR 13/12, aaO Rn. 35 ff.[↩]
- BGH, Urteile vom 28.10.2015 – VIII ZR 158/11, aaO Rn. 66 ff.; und – VIII ZR 13/12, aaO Rn. 68 ff.[↩]
- BGH, Urteile vom 28.10.2015 – VIII ZR 158/11, aaO Rn. 101, und – VIII ZR 13/12, aaO Rn. 103[↩]
- BGH, Urteile vom 28.10.2015 – VIII ZR 158/11, aaO Rn. 101 ff., und – VIII ZR 13/12, aaO Rn. 103 ff.[↩]